Er
soll klein sein, wie ein kleines Kind, von der Größe her wie ein Kind im
Alter von drei, fünf, sechs oder zwölf Jahren. Nur ab und zu wird er als
erwachsener Mann bezeichnet oder auch als riesengroß. Andere Überlieferungen
beschreiben den Wassermann als alt und buckelig. Seine Augen sollen hell und
funkelnd sein. Schaut ihm eine Frau in die Augen, wird sie krank und stirbt
bald darauf. Andere Legenden sprechen davon, dass seine Augen schön, bläulich,
rot, grün, oder Smaragdrot sein sollen.
In Polen und Tschechien hat der Wassermann mitunter Pferdefüße. Auch in den Sagen der Gebrüder Grimm taucht ein Wassermann auf, der seine Beine verdeckt.
In einigen Sagen ist der Wassermann nackt und hat dann einen grünen Körper, zum größten Teil ist er jedoch bekleidet. Seine Kleidung wird am häufigsten als Grün oder Rot beschrieben, aber auch Grau oder Schwarz und nur ab und zu als Gelb, Weiß oder Braun.
Sie ist aus Stofffetzen zusammen gesetzt oder zerrissen. In der Oberpfalz erscheint er jungen Frauen, zu denen er sich hingezogen fühlt, in einem Hemd mit gläsernen Gürtel. Damit versteckt er die Fischschuppen auf seinem Rücken. In einigen Sagen trägt er einen Sack oder Korb auf dem Rücken. Er trägt auch eine Kappe oder Mütze auf dem Kopf, die häufig Grün, aber noch öfter Rot ist. Oft ist es eine Mütze, aber auch ein Hut wird erwähnt. Am leichtesten erkennt man einen Wassermann daran, dass er immer von Wasser umgeben ist – das heißt, es läuft ihm aus den Haaren, der linken Tasche seines Rockes, aus der linken Seite oder aus dem Saum seines Gewandes, der immer nass ist.
Im polnischen Schlesien erscheint der Wassermann als Junge, der ungefähr 18 Jahre alt ist. Seine Hautfarbe ist blass, er mit grasgrünen Wangen. Er besitzt Froschaugen, Pferdeohren, Schwimmhäute an Händen und Füßen oder auch Pferdefüße und –hufe. Der Wassermann geht seitwärts, um zu verhindern, dass man ihm ins Gesicht sieht. Aus dem linken Ohr, dem Ärmel oder der Mütze läuft Wasser. Er kann sich verwandeln, beispielsweise in eine Maus, einen Frosch, einen Hasen, einen Hund, ein Pferd, einen Ziegenbock, mitunter sogar in einen Baum, Stein, eine Puppe oder einen goldenen Wagen.
Über die Nixe[2] ist bekannt, dass ihr Oberkörper dem eines Menschen gleicht, der Unterleib hingegen der eines Fisches oder einer Schlange ist. Nimmt sie mit den Menschen Kontakt auf, verwandelt sie sich auch in einen Menschen. In einigen Legenden heißt es auch, dass sie zu Mittag oder aber immer am siebenten Tag eine menschliche Gestalt hat.
Nur in deutschen Sagen, vereinzelt auch aus Schlesien wird überliefert, dass die Nixen klein, zum Teil auch winzig sind. Ihre Augen hingegen sollen groß und grauenhaft sein oder auch klein und wässrig. Sie haben aber auch Froschaugen sowie grüne Zähne. Die Haare sind gelb, blond, golden oder blauschwarz. Letzteres in Brandenburg. Die Haare sollen fast bodenlang sein. Auf dem Kopf tragen sie einen Schilfkranz.
Die meisten Überlieferungen sagen über die Nixen, dass sie unglaublich schön sind. In einigen ist der Körper aber auch meergrün oder blau, vereinzelt besitzen sie auch nur ein Nasenloch oder haben ein Gesicht, das dem eines Hundes gleicht. Die Kleidung der Nixen soll weiß, blau, rot, vereinzelt aber auch nur die Strümpfe rot sein.
Aus der Oberpfalz gibt es die Legende vom Wasserfräulein, deren Saum des Gewandes, die Schürze oder auch die vereinzelte Haare immer nass sind. Man erkennt sie daran, dass sie überall feine Wassertröpfchen zurück lässt.
a) Der Wassermann als
Pferd
Er tritt, wie schon erwähnt, am häufigsten in der Gestalt eines Pferdes in Erscheinung[4]. Wenn er sich in ein solches verwandelt hat, lässt er sich fangen, indem man ihm ein Halfter aus geweihter Erlenrinde umhängt. Gibt man ihm Wasser, verschwindet er. Das Pferd-Wassermann arbeitet doppelt so viel wie ein normales Pferd. Setzte man ihm auf dem Feld beim Eggen ein, verschwand er, sobald sich zwei Furchen kreuzten. Auch den Anblick eines Kreuzes hielt das Wassermann-Pferd nicht aus.
Wassermänner können sich in Schimmel oder Rappen verwandeln. Sie kommen in der Nacht aus dem Wasser, fressen Hirten, die sich ahnungslos am Ufer aufhalten oder führen Menschen, die es wagen, auf sie aufzusteigen, ins Wasser. Sie treiben auch Wagen hinein. Im Katholizismus gab es den Aberglauben, dass Menschen, die am Karfreitag nicht in die Kirche gingen, von den Wassermännern geholt würden.
b)
Der Wassermann als Stier oder Kalb
Stiere, die aus dem Wasser kamen, finden sich in einigen Erzählungen.[5] So sollte in Serbien in jedem See ein Wassermann leben. Dem musste man Gold opfern, bevor man die Schafe gewaschen hat. Andererseits gibt es Erzählungen, in denen berichtet wird, dass sich der Wassermann immer zu Mittag einen Bullen geholt hat. Eine alte Schweizer Sage berichtet vom Kampf zweier Stiere, die aus dem See kamen.
Im Osten besitzt der Wassermann oft das Aussehen eines weißen Kalbes, in Schwaben hingegen das einer weißen Kuh. Aus dem Tal Domleschg im Schweizer Kanton Graubünden wird von einem Seeungeheuer berichtet, das einen riesigen Kuhbauch und tausende Augen besitzt. Kommt es aus dem Wasser, sind die Verwüstungen verheerend.
c)
Der Wassermann als wildes Tier oder Haustier
Wassermänner verwandeln sich auch gerne in schwarze Böcke oder reiten auf ihnen.[6] Sie sollen auch als Böcke mit einer Kerze zwischen den Hörnern gesehen worden sein. Eine tschechische Sage berichtet von einem schwarzen Bock, der kranke Kühe durch Lecken wieder heilte und anschließend verschwand. Er hinterließ einen Wasserfleck, der nur durch Weihwasser beseitigt werden konnte.
Im polnischen Schlesien wird von Wassermännern berichtet, die sich in Schweine verwandelten.
Im Tiroler Lechtal wurde ein Wassermann gemieden, der in Gestalt eines zottigen Wasserhundes die Menschen heimsuchte. Auch in Nordthüringen und Schlesien erscheint der Wassermann als Hund.
Der Nickelkater wird in einer Sage aus Magdeburger Börde (eine Landschaft in Sachsen-Anhalt) erwähnt. Er lauert Kindern auf und zieht sie ins Wasser.
In der Gestalt eines Bären zeigt sich der Blutschink, der im See am Ausgang des Tiroler Panznauntales lebt.
Ein Wassermann ist auch der Hirsch, der auf dem Eis eines Klostersees auftaucht und so an ein fälliges Wasseropfer erinnert. Ebenso wie der Hase, der eine rote Blume besitzt und durch einen zugefrorenen Teich schwimmt.
Im Stechlin bei der Mecklenburger Seenplatte gibt es einen bösen Riesenhahn, der purpurrot ist. Auch in Mähren gibt es den Wassermann in Gestalt eines Huhns.
e)
Der Wassermann als Wassertier
Hier sind Gänse, rote Enten, Frösche, Kröten und Molche überliefert. Auch von einem Otter wird berichtet, der Kinder ins Wasser zieht.
Es gibt die Sage von einem Fisch, der vom Wasser aus angerufen wird und antwortet. Fängt ihn ein Fischer, muss er ihn wieder zurück geben, da ihm sonst Unheil widerfahren wird. Dieser Fisch soll unheimlich groß sein und einen Menschenkopf haben. Überlieferungen aus Sachsen oder der Lausitz berichten, dass er keinen Schwanz hat.
f)
Der Wassermann als Wasserpflanze
Die Pflanzen werden oft mit Nixen als mit den Wassermännern in Verbindung gebracht.[7] Noch heute gibt es Namen wie Nixenblume, Froschbiss, das Wassergras wird volkstümlich auch Nickelmannshaar genannt usw. In Schlesien sollen die Töchter des Wassermannes ihre Köpfe aus den Wasserlilien hervorstrecken und im Böhmerwald verwandelt sich der Wassermann in eine Teichrose oder Seelilie und fängt in dieser Gestalt seine Opfer.
g)
Wassermänner und Irrlichter
Die
Wassermänner werden auch mit den Irrlichtern in Verbindung gebracht.[8]
Er zieht die Irrlichter an oder erscheint als Irrlicht, beispielsweise einem
Fischer, der es wagt, am Karfreitag zu fischen. Am Bodensee soll ein
Wassermann sein Unwesen treiben, der die Fischer neckt. Er becirct diese so
lange, bis sie ihm ein Band oder ein Seil zuwerfen, das er dann anzündet
und erklärt, er hätte, so lange das Band brennt, keine höllischen Qualen.
Auch im Allgäu gibt es diese „feurigen Männer“. Selbst die
Spinnerinnen überredet er, ihm einen Faden aus dem Fenster zu reichen. Ist
dieser recht lang, so lacht er.
Wassermänner und ihre Familie
Aus
verschiedensten Überlieferungen gibt es die Vorstellung, dass Wassermänner
in Familien zusammen leben[9].
Die Erziehung des Wassermannes gegenüber seinen Töchtern ist streng. Die
weiblichen Wassernixen sind immer in Dreiergrüppchen unterwegs und tanzen
sehr gerne.
Den Sagen zufolge gelten die Wechselbälger, also die untergeschobenen Säuglinge, als Kinder der Wassermänner. Verschiedene Legenden berichten, dass Wassermänner mitunter auch Hebammen in die Tiefe ihrer Gewässer holen, damit sie ihrer Frau bei der Geburt beistehen. Nach der Entbindung werden sie vom Wassermann gefragt, wie viel sie dafür haben möchten. Die Hebamme darf nur so viel verlangen, wie ihr zusteht – verlangt sie mehr, kostet das ihr Leben. Der Wassermann befiehlt ihr, die Stube auszukehren und das Zusammengekehrte mitzunehmen. Ist sie wieder an der Wasseroberfläche angekommen, hält sie Gold in Händen. In einigen Sagen, schüttet die Frau den Staub auch weg und merkt zu spät, was sie weg geworfen hat. Statt des Kehrichts bekommt die Hebamme auch Stroh, Laub, einen Wunderknäuel oder einen Ring. In einer Sage aus dem Harz erhält die Hebamme das Versprechen, das in ihrem Heimatdorf niemals Feuer ausbrechen wird. In anderen Überlieferungen muss die Hebamme sofort nach dem Auftauchen eine Weidenrute ergreifen, damit der Wassermann ohnmächtig wird.
Vom
Wassermann ist auch überliefert, dass er seine Kinder fressen soll. Dies
wird durch eine Spindel, die auf dem Wasser schwimmt, angezeigt.
Das
neu geborene Kind besitzt oft einen großen Kopf, eine gebogene Nase und
wulstige Lippen.
Behausungen der Wassermänner
Sie
sollen in Brunnen, Quellen, Wasserlöchern, Sümpfen, Bächen und Flüssen
wohnen, aber auch in Seen und im Meer.
Die
Wohnung in der der Wassermann mit seiner Familie lebt, wird oft als Palast
geschildert, mit Gold und Edelsteinen geschmückt, aus anderen Sagen heißt
es, dass die Wohnung eine Bauernstube ist oder ein grünes Haus. Näheres
ist jedoch aus den Überlieferungen nicht zu erfahren. In einer Sage heißt
es, dass er Boden mit Fischaugen gepflastert ist, ein anderes Mal, dass auf
dem Tisch Essen gestanden hat, das verlockend aussah, aber tatsächlich aus
Kröten und Schlangen bestand.[10]
In
der Behausung selbst soll es kalt sein. Zur Wohnung führt eine Treppe, zu
der der Wassermann einen Zugang öffnet, indem er mit der Rute ins Wasser
schlägt.
Beziehungen von Wassermännern und Menschen
Ehen
zwischen Menschen und Nixen werden freiwillig eingegangen, während Wassermänner
eine Ehe zu einer Menschenfrau nur unter Zwang erreichen können.
In
einer Sage vom Wörthersee in Österreich heißt es, dass er jedes Jahr ein
paar Mädchen in sein Kristallschloss holt.
Für das Ende der Sagen gibt es drei verschiedene Ausführungen: Das Mädchen wird beim Tanz entführt, der Wassermann wird abgewiesen oder das Mädchen stirbt früh, weil es doch Sehnsucht nach dem Wassermann hat.
Es
gibt die österreichische Sage vom Donaufürsten, dessen Frau, einst eine
Menschenfrau, jedes Mal einen Blumenstrauß über die Wasseroberfläche
treiben lässt, wenn jemand ertrunken ist. [11]
Die Geschichte der meisten Sagen, in denen die Menschenfrau beim Wassermann bleibt, berichtet, dass er mit dieser sechs oder sieben Kinder zeugt. Einmal will sie aber wieder auf die Erde und zur Kirche gehen. Der Wassermann erlaubt es ihr, sagt aber, sie soll noch vor dem Segen die Kirche wieder verlassen. Natürlich tut sie es doch und wird dafür auf unterschiedliche Weise bestraft.
Eine
oberpfälzische Sage berichtet, dass eine Schwangerschaft von Mädchen, die
vom Wassermann geschwängert wurden, für die Menschen unbemerkt bleibt und
der Nix das Kind nach der Geburt auch genau so unbemerkt wegnimmt. [12]
Wassernixen
locken des öfteren ahnungslose junge Männer durch Musik und Gesang zu sich
und ziehen sie ins Wasser hinab. Durch die Umarmungen holen sie sich Jugend
und Schönheit. Natürlich sterben die jungen Männer und deren Leichen
erscheinen am siebenten Tag am Ufer. Sie sind in feine Netze gewickelt und
tragen eine Lilie in der Hand. Die meisten Sagen aber berichten, dass sie
die jungen Männer in die Tiefe holen, um sie zu heiraten.
In
den meisten Legenden ist der menschliche Jüngling bereits verheiratet oder
lässt die Nixe auch im Stich. Beispielsweise in der Erzählung der
Melusine, deren älteste Überlieferungen aus dem 12. Jahrhundert stammen.
Melusine, eine Wasserfee, heiratet einen Menschenmann. Sie verlangt von ihm,
dass er sie an einem bestimmten Tag nicht ansehen darf. An diesem Tag
verwandelt sie sich in ihre ursprüngliche Gestalt zurück – der einer
Wasserfee mit Schlangenkörper. Als er es dennoch tut, muss sie ihn
verlassen.
Auch
soll Dietrich von Bern, eine Sagenfigur des deutschen Hoch- und Spätmittelalters,
soll eine Wasserfrau zur Mutter gehabt haben[13].
Wassermänner und Kinder
Die
Wassermänner werden oft dafür verantwortlich gemacht, Kinder
auszutauschen, so genannte Wechselbälger. Diese Kinder haben einen großen
Kopf, der von alleine wächst. Sie lernen weder gehen noch sprechen, sind hässlich,
behaart, schreien den ganzen Tag, haben Kalbsaugen, einen mageren und sehr
bleichen Körper und krächzen wie Raben. Die Frauen merken es nicht sofort,
weil das untergeschobene Kind dem echten eine Zeitlang sogar ähnlich sieht.
Wassermänner trifft auch die Schuld, wenn Kinder tot auf die Welt kommen.
Der
Austausch erfolgt kurz nach der Geburt oder wenn die Mutter mit dem Kind in
der Nähe des Wassers ist. Dieser Kindestausch ist jedoch nur dann möglich,
wenn das Kind noch nicht getauft ist, also innerhalb der ersten sechs Wochen
oder dann, wenn Mutter und Kind fest schlafen. Auch Frauen, die eben erst
geboren haben, sind vor Wassermännern nicht sicher. So sollen sie Frauen
entführt haben, die alleine im Bett gelegen sind.[14]
Die
Mutter hat auch die Möglichkeit, diesen Austausch zu verhindern, indem sie
dem Kind, wenn sie zur Arbeit geht, ein Gesangbuch unter den Kopf legt oder
einen Vogel im Zimmer hält. Damit hat der Wassermann keine Gewalt über das
Kind. Eine andere Möglichkeit ist, die Türen in der Nacht mit einem
Schurzband zuzubinden und das Kind nachts nicht alleine zu lassen. Auch soll
man, wenn man einen Orant, eine so genannte frühchristliche betende Figur,
im Garten aufstellt, die Entführung des Kindes verhindern können. Wenn die
Mutter mutig ist, kann sie den Wassermann auch fortjagen – aber als
Zeichen dafür bleiben dem Kind auf der Stirn vier rote Flecken. Auch wurde
in einigen Legenden der Nix durch das Niesen des Neugeborenen oder den „Helf-Gott“-Ruf
eines Bettlers noch verscheucht[15].
Man kann das Kind auch zurücktauschen – dafür schlägt man entweder mit der Rute oder mit einer Peitsche auf das untergeschobene Kind und spricht dazu „Nimm dir das deine und bring mir das meine“, dann bringt der Wassermann das echte Kind zurück. Jedoch gab es den Aberglauben, dass die Nixe dem eigenen Kind alles das antut, was man ihrem Kind antut. Deshalb ließen manche Eltern das Kind auch lieber bei den Nixen und behandelten statt dessen das untergeschobene Kind gut, weil sie wussten, dass es dem eigenen Kind dadurch gut geht.
Vom
Plöckenstein, einem Berg im Dreiländereck Deutschland, Österreich und
Tschechien, gibt es die Überlieferung, dass ein Vater, dessen Kind tot
geboren oder ausgetauscht wurde, einem neu geborenen Kalb dem Kopf
abschneiden soll, sich damit auf eine Brücke stellt und den Kalbskopf, rücklings
ins Wasser werfen soll. Dann muss er ohne sich umzuschauen nach Hause gehen.[16]
Von
diesen untergeschobenen Kindern gibt es auch den Glauben, dass sie sehr
stark sein sollen.
Manchen
Sagen nach bringen die Wassermänner aber auch die Kinder, beispielsweise in
Schlesien, wo er Babys und neugeborene Tiere bringt. Die Hebamme soll von
ihm die neu geborenen Kinder aus dem Brunnen erhalten, während sie Nixe aus
einer Quelle holt. Auf Helgoland gibt es Legende, dass sich das Meerweib
Schwangeren zeigt und ihnen auch bei der Geburt zur Seite steht. Statt der
Wasserfrau ist es auch eine weiße Frau oder Maria.[17]
Die Tätigkeit der Wassermänner
Der
Wassermann ist oft am Wasser zu finden. Er sitzt dort auf Steinen, auf den Bäumen,
auf der Brücke oder am Fluss selbst. Die Sagen erzählen, dass Wassermänner
beispielsweise die Schiffe, die auf der Salzach (Österreich) fahren,
stromaufwärts ziehen, im Wesenberger See in Brandenburg treiben sie die
Fische vor sich her. Aus Überlieferungen aus dem Osten wird erzählt, dass
Wassermänner Geld zählen, sich Feuer für die Pfeife holen oder mitunter
auch auf den Markt einkaufen gehen, während Wasserfrauen zu den Menschen
kommen, um zu betteln.
Schon
Martin Luther (1483 bis 1546) schreibt von der Nixe, dass sie sich in Österreich,
Böhmen, Sachsen zur Mittagszeit, aber auch beim Wechsel der Gezeiten auf
einem Felsen, auf Steinen oder auch am Ufer sitzend die Haare kämmt. Der
Kamm, den sie dabei verwendet, ist einer mit sehr feinen Zähnen. Oft ist
auch überliefert, dass sie sich die Haare flechtet statt kämmt.[18]
Mitunter
sollen Wassermänner auch ihre Schuhe oder die Kleidung flicken, die aus
zahlreichen Lappen zusammengesetzt ist. Statt des Nähens berichten Sagen
auch von einem Zählen dieser Fleckchen. Wer den Wassermann dabei
verspottet, wird dafür bestraft, in einer Sage soll sogar die Nixe die
kleinen Buben ertränken. Letztendlich wird der Wassermann zu einem
gelernten Schuhflicker, der für die Menschen die Schuhe flickt. Legenden
berichten, dass die Menschen diese Schuhe sehr gerne trugen.[19]
Wasserfrauen
waschen an Flüssen, Bächen, Teichen und Seen ihre Wäsche. Die Wäsche
legen sie ans Ufer zum Trocknen und Bleichen. Sie sieht aus wie Spinnweben,
weiß und fein. Kommen Menschen in ihre Nähe, verschwinden die Wasserfrauen
im Wasser. Das Auslegen der Wäsche soll auf gutes oder schlechtes Wetter
oder auf Hochwasser hindeuten. Dieses Wäschewaschen wurde dann in Erzählungen
erweitert, beispielsweise dass die Nixen ihre Haare waschen oder sich die Wäsche
von selbst wäscht.[20]
Andere Überlieferungen wiederum besagen, dass Menschen ertranken, weil sie
trotz Warnungen die Wäsche mitgenommen haben. Die Haupt-Waschzeiten sind
zur Mittagszeit, in der Johannisnacht oder in der Weichnachtszeit. In Lupow,
einer Stadt in Pommern, galt es als streng verboten, nach Sonnenuntergang
die Wäsche zu waschen, da diese sonst von den Wasserfrauen mitgenommen
wurde.
Wassermänner
sollen auch backen können[21].
Normalerweise wird das den Erd- oder Waldgeistern zugeschrieben, aber die
Legende kommt auch bei Wassermännern vor. Demnach sollen Bauern, die am
Ufer mähen oder pflügen ein Backgeräusch im Wasser hören oder sehen, wie
sich das Wasser mit Rauch füllt. Sie rufen daraufhin „Wenn ihr einen
Kuchen gebacken habt, so lasst uns auch etwas zukommen.“ Daraufhin
erscheint ein Kuchen mit Bier. Der Wassermann stellt dann den Bauern die
Bedingung den Kuchen zu essen, aber alles ganz zu lassen oder aber den
Kuchen zu essen oder ihn zu zerschneiden. Und das Bier sollen sie trinken,
ohne das Glas zu berühren. Die Bauern greifen zu einer List und essen das
Innere des Kuchens, ohne das Äußere zu zerschneiden und trinken das Bier
mit einem Strohhalm oder einem Schilfrohr. Der Wassermann verschwindet
zornig.
Nixen
sollen wunderschön singen können – und durch diesen Gesang werden junge
Männer angelockt. Aber sie sollen auch Instrumente spielen können, wie
Pfeifen oder Walzer. In Südböhmen gibt es einen Wassermann, der Kinder mit
seinem Flötenspiel in den See lockt. Aus der Steiermark gibt es die Überlieferung,
dass es am Nachmittag ein Gewitter geben soll, wenn die Jungfrauen in den
Seen der Alpen singen. Und der Wassermann, der im Wildsee in Baden-Württemberg
lebt, deutet mit seinem Spiel immer auf ein nahendes Unglück hin.[22]
Seltener
ist in den deutschen Sagen vom Tanz der Nixen die Rede. Viel häufiger ist
überliefert, dass die Nixen bei ihren Ausflügen zu den Menschen an
bestimmte Zeiten gebunden sind – überschreiten sie diese, werden sie vom
Wassermann bestraft. Ab und zu erscheinen die Wassernixen am Johannistag und
tanzen. Viel öfter treten die Nixen jedoch als Helferinnen beim Spinnen in
Erscheinung. Sie kommen und helfen, wollen aber dafür weder Essen noch Getränke
und wollen auch nicht, dass sie von den Menschen nach ihrer Herkunft gefragt
werden.[23]
Tauchen
die Wassernixen aus dem schon erwähnten Wildsee bei Hochzeiten auf, sollen
sie der Braut Glück und Segen bringen. Es gab daher den Brauch, dass die Bräute
drei Tage vor der Hochzeit zum See gehen und die Nixen mit dem Ruf „Ich
habe Hochzeit, komm’ zum Tanze“ einladen.
Andere
Legenden berichten darüber, dass die jungen Männer die Wassernixen zum
Ufer begleitet und von ihnen ins Wasser mitgenommen worden sind, indem die
Jungfrauen mit einer Rute ins Wasser schlugen und sich so ein trockener
Zugang öffnete. Unten angekommen wurden sie bewirtet und öfter in letzter
Sekunde vor dem Wassermann gerettet, der das Christenblut riechen kann und
sie deshalb bedroht. Sind sie wieder am Ufer angekommen, verwandelt sich
alles, was sie von unten mitgenommen haben, in Gold.[24]
Wassermänner und ihre
mitunter feindliche Beziehung zu den Menschen
Wassermänner
ärgern die Menschen gerne. Und das kann mitunter auch böse ausgehen. So
sollen sie Frauen durch ihren Zuruf „Häng dich auf“
dazu bringen, dass sie genau das tun. Auch ahmen sie mit Vorliebe
Ertrinkende nach und lassen die Boote von Fischern auf einen Baum auflaufen.
Sie steigen selbst in Fähren ein und lassen sich von Fährmännern übersetzen
– dieser darf aber dabei weder sprechen, noch seinen Gast ansehen, sonst könnte
er das mit dem Leben bezahlen. Mitunter soll der Wassermann als Hund, Kalb
oder auch als alte Frau gesehen worden sein.
Will
er die Menschen ärgern, springt er auf deren Rücken, verschwindet aber
beim Ruf „Jesus Maria“ wieder.
Aus
dem Osten wird immer wieder überliefert, dass der Wassermann mit
vorbeikommenden Menschen kämpft. Ein Mann kämpfte drei Mal mit dem Nix,
beim dritten Mal kostete es ihm das Leben. Eine andere Überlieferung erzählt,
dass der Wassermann beim Kampf erfolglos seinen Fuß in den Boden gegraben
hat, um etwas Wasser darin zu finden. Dann wäre es sein Sieg gewesen. Diese
Wiesen sind an der Stelle bis heute ohne Wasser[25].
Der
Wassermann spukt besonders gerne in Mühlen. Davon zeugen Überlieferungen
aus dem Osten Deutschlands, aber auch aus Franken oder Schleswig-Holstein
wird dies übermittelt. Meistens ärgert der Nix den Müller dadurch, in dem
er in der Nacht Fische brät, Milch aus dem Stall holt, sich am Ofen wärmt,
das Mühlrad abstellt oder es beschleunigt, bis er durch den Bären eines Bärenführers
vertrieben wird.
Wassermänner
ertränken Menschen gerne im Wasser, besonders Kinder. Wenn also früher
Kinder ertrunken sind, hieß es oft, der Wassermann habe sie geholt[26].
Daher wurde der Wassermann auch gerne als Kinderschreck verwendet. In Sagen
wurde auch der Nixe ein neugeborenes Kind versprochen.
Der
Wassermann soll die Menschen ins Wasser ziehen, wenn sie unvorsichtig sind
und am Ufer schlafen (beispielsweise in Tiroler Sagen). Auch der Blick des
Wassermanns soll dazu führen, dass die Menschen wie magisch von ihm
angezogen ins Wasser gehen. In anderen Überlieferungen bedienen sich die
Wassermänner Hilfsmittel, um die Menschen in ihr Reich zu bringen. So
wickeln sie Schilf um die Füße der ahnungslos Badenden, die Leichname, die
von einer Nixe ertränkt wurden, tauchen - in ein feines Netz gewickelt –
wieder auf. Für die Kinder benutzen Wassermänner einen Haken oder einen
unsichtbaren Haken, mitunter auch einen Pilgerstab[27].
In
Brandenburg, der Lausitz, Böhmen und Schlesien verwendet der Wassermann
bunte Bänder, Tücher, Wäsche, die er über dem Wasser, am Ufer, an Bäumen
oder an der Brücke aushängt, sie verkauft, den Menschen zuwirft oder dort
ausmisst und so die Neugier der Vorübergehenden erweckt.
In
einigen Sagen verkleidet sich der Wassermann als Hochzeitsführer und trägt
einen Stab aus bunten Bändern oder stellt einen Maibaum mit bunten
Schleifen auf. Oft streckt der Ertrunkene einen Arm aus dem Wasser, in dem
er einen Stock mit bunten Bändern hält.
Der
Wassermann, der in der Donau lebt, auch Donaufürst genannt, erwürgt die
Kinder mit einer Korallenkette, vom schlesischen Wassermann werden sie
wiederum durch eine silberne Uhr angelockt. Auch die Nixen sind den Menschen
mitunter feindlich gesinnt. Sie stellen Hausschuhe ans Ufer, um die jungen Mädchen
damit in ihr wässriges Reich zu locken.
Aber
auch durch Gesang oder Rufen ziehen sie die Menschen an. Oft wird durch
dieses Rufen auch als Vorankündigung des nahenden Todes eines Menschen verkündet.
Seltener
wird erwähnt, was der Wassermann dann mit seinen Opfern anstellt. Ab und zu
heißt es, dass die Ertrunkenen von ihm gefressen werden oder er mit ihren Körpern
die Fische füttert, sie am ganzen Körper zerkratzt. Dem Blutschink oder
dem Brabanter Necker[28]
wird nachgesagt, dass sie das Blut ihrer Opfer aussaugen[29].
So
sollen auch Menschen, die dem Wassermann gerade noch entkommen konnten, als
Zeichen dafür einen blauen Streifen am Hals tragen oder schwarze Male
haben. Ein Mensch, dem der Wassermann auf den Rücken geschlagen hat, trägt
als Zeichen dafür den Abdruck einer Männerhand, die einen besonders großen
Daumen hat. Nach den tschechischen Sagen soll der Wassermann Menschen, die
er fürs Ertrinken auserwählt hat, mit einem roten Bändchen kennzeichnen,
wenn sie ihm entwischten. Diese Menschen ertrinken dann von selbst.
In
Böhmen, Schlesien, Niederösterreich, Tirol aber auch Franken hebt der
Wassermann die Seelen der Ertrunkenen in umgestürzten Töpfen, Gläsern
oder Flaschen auf, die er in seinem Palast oder seiner Stube aufbewahrt. Oft
gibt es auch Sagen, in denen meistens ein Mädchen als Dienerin zum
Wassermann kommt und die gefangenen Seelen befreit. Die befreiten Seelen
verwandeln sich oft in weiße Tauben.
In
Sagen aus Tirol und Tschechien werden die Seelen von den Wassernixen
bewacht, die sie auch ab und zu vor dem Wassermann verteidigen, wenn er eine
frei geben möchte.
Nach einer Sage aus dem Böhmerwald haben die ertrunkenen Jungen die Aufgabe, die Wohnung des Wassermanns zu kehren und auch die großen Kessel zu heizen, in denen die Seelen der verdammten Menschen kochen. Eine Sage aus Schlesien berichtet, dass der Wassermann die Seelen der Ertrunken mit Eis überzieht und sie in seinem Haus hält. Eine Legende aus Kärnten berichtet wiederum, dass die verdammten Seelen unter der Erde arbeiten müssen, um das Wasser hinauf zu pumpen.
Das
Ziel des Wassermanns ist, am Jüngsten Tag genau so viele Seelen zu besitzen
wie Gott.
Vielfach
wird jedoch berichtet, dass Ertrunkene wieder auftauchen und doch keine Ruhe
finden. Sie spuken als Geister am Wasser umher, auch tun dies nicht
Ertrunkene gerne. Eine Sage aus Brandenburg berichtet darüber, dass
Ertrunkene früher immer am Strand beerdigt wurden. Auch sollen die Geister
der so Verstorbenen auch gerne die Schifffahrt stören[30].
Auch Selbstmörder oder Mütter, die ihr Kind im Wasser ertränkt haben,
spuken als Geister. Allgemein sind die Seelen Ertrunkener ans Wasser
gebunden. So erzählt eine Sage vom Ziereiner See im Salzburger Land, dass
dort viele Seelen als Fische herumschwimmen und erst dann erlöst sind, wenn
der See austrocknet. Darüber hinaus sollen die Menschen, wenn genau das
eintritt, auf den Grund des Sees ins Berginnere kommen und dort viele Schätzen
finden. In den Rachelsee in Bayern darf man keine Steine werfen, da sonst
die Ruhe der verstorbenen Seelen gestört wird. Dort leben die Seelen, die
im Grab keine Ruhe finden. Bauern, die eine schlechte Tat begangen haben,
werden in den Tiroler Pillersee verbannt. Im selben See soll auch Pontius
Pilatus leben, der jedes Jahr in der Karwoche unter entsetzlichen Schmerzen
leidet. Er soll dabei wie ein Stier brüllen. Bekannter ist jedoch, dass er
in dem nach ihm benannten Schweizer See sein Unwesen treiben soll[31].
Aus
vielen Legenden ist bekannt, dass Flüsse, Seen und Teiche jedes Jahr ihre
Opfer fordern. Und nicht immer ist es ein Wassermann oder eine Wasserfrau,
der diese Opfer verlangt. Der Mensch muss einigen Mythen nach nur alle
sieben Jahre geopfert werden, andere Überlieferungen sprechen von drei
Opfern pro Jahr. So soll man in den Lausitzer See drei Mal gehen können,
ohne zu ertrinken, beim vierten Mal kostet es jedoch das Leben.
Als
gefährlichste Zeit, um zu ertrinken, wird vielfach der Johannistag genannt,
aber auch Walpurgis, Christi Himmelfahrt, Pfingsten, das Dreieinigkeitsfest
(Trinitatis), der erste Tag in der Woche nach der Pfingstwoche, Peter und
Paul (29. Juni), Prokopi (4. Juli), Jakobi (25. Juli), der schwarze Sonntag
(30. September), der Totensonntag (Sonntag vor dem 1. Advent), die
Andreasnacht (30. November), sowie der Freitag, an denen laut der Sagen die
Tore zum unterirdischen Reich des Wassermanns offen stehen oder auch die
Mittagszeit gelten als gefährliche Zeiten. An diesen Tagen und Zeiten soll
sich der Mensch vom Wasser fern halten, auch nicht über Brücken gehen. Es
ist auch überliefert, dass sich der Wassermann an bestimmten Stellen aufhält
– wer diese betritt, ertrinkt. Für das vom Schicksal auserwählte Opfer
gibt es kein Entkommen vor seinem Schicksal – und wenn er auch nur bis zu
den Knien im Wasser steht. So berichten Erzählungen, dass ein Mensch, der
gerade noch davor zurück gehalten werden konnte, sich ins Wasser zu stürzen,
gleich darauf durch einen Schluck Bier, Wasser oder Wein ertrank[32].
Besonders
Kinder, die im Sternzeichen des Wassermanns geboren sind, sind durch den
Wassermann gefährdet. Die Mutter kann jedoch drohende Gefahr abwenden,
indem sie vor der Taufe eine Münze oder ein getragenes Kleid des Kindes ins
fließende Wasser wirft. Der Wassermann ruft angeblich auch dreimal den
Namen seines Opfers oder eine Stimme aus dem Wasser ruft ihn. Auch weisen
Klagen des Wassermanns, das Singen der Nixen, Lachen, Händeklatschen auf
den bevorstehenden Tod eines Menschen hin. Auch wer den Wassermann sieht,
muss angeblich nach drei Tagen ertrinken.[33]
Was passiert, wenn der Wassermann gekränkt wird?
Wenn
der Wassermann Menschen ertränkt, so haben sie sich das laut vielen Sagen
selbst zuzuschreiben. Denn schließlich haben sie ihn gekränkt und
verspottet. Beispielsweise ist er ungerechtfertigt beschuldigt worden, die Wäsche
verschmutzt zu haben.
Darüber
hinaus gibt es aber auch einige Handlungen, die der Wassermann gar nicht
leiden kann. So erbosen ihn die Menschen durch das Überschwimmen seiner
Reiche, also der Seen und Gewässer. Es gibt mehrere Überlieferungen, nach
denen Menschen, die wetteten, ein bestimmtes Gewässer dreimal oder 100 Mal
überschwimmen zu können, beim dritten oder 100. Mal dem Wassermann zum
Opfer fielen. Eine Sage vom Oberblegisee beim Kanton Glarus in der Schweiz
erzählt, dass der Hirte, der ihn durchschwimmen wollte, seinen Kopf verlor,
weil ihm dieser vom Wassermann abgebissen wurde. Diesen fand dann die
Mutter, die auch im See schwamm.
Auch
verhindert der Wassermann, dass man die Tiefe eines Gewässers misst. So
sollen jenen, die dies versucht haben, eine Stimme mit den Worten „Ergündst
du mich, so schlünd ich dich“ davor gewarnt haben. Allerdings fehlt
meistens ein Hinweis darauf, welche Stimme das war. Nur eine Sage aus dem
Elsässer Münstertal erzählt, dass es eine Wassernixe gewesen sein soll.
Sonst heißt es meistens, dass es die Stimme eines Geistes war, eines unglücklichen
Ertrunkenen, der auf dem Meeresboden lebt.
Und
dennoch haben es einige probiert – und sind kläglich daran gescheitert.
So soll statt dem an den Strick befestigten Wagenteil eine Pferdekopf zum
Vorschein gekommen sein, in anderen Fällen auch ein Tuch mit einer goldenen
Inschrift, deren Entzifferung allerdings nicht möglich war.
Das
Werfen von Steinen
Dies soll – laut einigen Sagen – fürchterliche Gewitter hervorrufen, die sogar das Land überschwemmen.[34]

Die
Nixen vom Mummelsee, |
Dies wird von vielen Seen überliefert, einige gibt es jedoch vom
Pilatussee, der im Kanton Luzern in der Schweiz zu finden ist und vom
Mummelsee, im baden-württembergischen Schwarzwald. Auch soll ein weißer
Steinhagel in einem schweren Platzregen enden. Angeblich sollen Wassermänner
Menschen ertränken, weil sie mit Steinen nach ihnen geworfen haben. Darüber
gibt es eine Tiroler Sage, nach der der Wassermann zuerst den frechen
Menschen warnt, ihn verfolgt und ihn schließlich auch erwischt und unter
Wasser zieht. Die
Wassermänner, die im Mummelsee leben, sollen alle hineingeworfenen Steine
wieder an Land tragen. |
Wie
ruft man Wassermänner?
Die
Legenden besagen, dass ein Mensch einen Wassermann auch herausfordern kann.
Dazu muss man ihn drei Mal bei seinem Namen rufen. Das funktioniert zum
Beispiel beim Vierwaldstättersee bei Waldstätten in der Zentralschweiz.
Hat man den Wassermann gerufen, muss man jedoch so schnell wie möglich
davon laufen.
Einigen
Überlieferungen nach überlebt Derjenige, der einen Wassermann
herausfordert, das Jahr nicht.
Ein
Unwetter gibt es am Pilatussee, wenn man den Wassermann ruft. Auch in den
Niederlanden werden die Wassermänner gerufen – allerdings in Reimform.
Was
passiert, wenn man einen Wassermann verletzt?
Eine
Legende erzählt davon, dass ein Metzger einem Wassermann oder einer
Wasserfrau, die ein Stück Fleisch haben wollten, die Hand abgehackt hat,
mit der sie auf eben dieses deuteten[35].
Der Täter muss bald darauf ertrinken, was normalerweise in einer kleinen
Lache geschieht. Auch das Geld, mit dem die Wassergeister die Ware bezahlen,
hat seine Tücken: So soll es alt sein, aus durchlöcherten Groschen
bestehen. Und ab und zu verwandelt es sich in Fischschuppen.
Aus
Kärnten stammt einer Sage, nach der eine Familie einem Wassermann, der nach
Essen gebettelt hat, heiße Nudeln gegeben hat, an denen er sich Mund und
Finger verbrannt hat.
Gibt
es auch freundliche Wassermänner?
Meistens
spielen Wassermänner den Menschen übel mit. Es gibt einige wenige Sagen,
die davon berichten, dass ein Wassermann einem Menschen geholfen hat. Wohl
aber gibt es einige wenige Legenden: Beispielsweise eine aus Schwaben, nach
der ein Wassermann einem armen Bauern den Samen für seine Ernte leiht –
unter der Bedingung, dass er das Geliehene auch wieder zurück gibt. Dieser
macht natürlich damit eine reiche Ernte.
Andere
wenige Sagen berichten darüber, dass der Wassermann im Haushalt hilft –
beispielsweise wäscht, die Kinder hütet, bäckt oder die Tiere füttert.[36]
Der Neck verschwindet wieder, wenn man ihm sein Essen nicht vorsetzt oder
die Milch mit Knoblauch statt mit Zucker „versüßt“.
Wassermänner,
die Menschen heilen
Auch
so etwas gibt es – obwohl der Wassermann an der Heilung eines Menschen
allerdings nicht aktiv beteiligt ist. Doch laut den Überlieferungen kann
einen Menschen ein Wasser, in dem sich der Wassermann aufhält, auch gesund
machen. So gibt es in Böhmen das Heidebrünnlein, dessen Heilkraft sich auf
den Wassermann oder auf die Wasserfrau zurückführen lässt. In Tirol
sollen wiederum die Wassernixen dafür verantwortlich sein, dass bestimmte
Heilkräuter in der Umgebung ihrer Quellen, Flüsse und Seen eine heilende
Wirkung besitzen.[37]
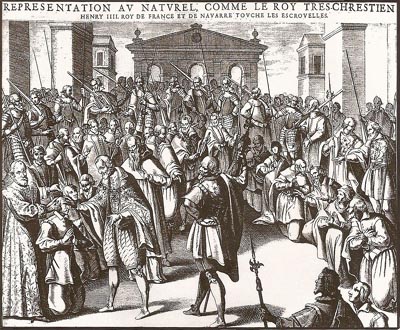
Heinrich
IV. legt einem Kranken die Hand auf. |
Von
der Nixe erbaten sich die Menschen, dass das Wasser gegen die Skrofulose
helfen solle, eine heute nur noch selten auftretende Krankheit, die vor
allem Kinder befiel. Die Kinder litten unter einer chronischen Entzündung,
die sich an Augenlidern, Nasenschleimhäute oder an den Halslymphknoten
bemerkbar machte. Ab dem Mittelalter bezeichnete man mit der Skrofulose alle
Arten von Krankheiten, darunter fielen auch Hals- und
Geschlechtskrankheiten. Um das 13. Jahrhundert herum herrschte in Frankreich
und England der Glaube, dass der rechtmäßige König die Skrofeln auch
durch Handauflegen heilen könne. Es wurde ein Heilungsritual initiiert, das
während der Krönungsriten wurde. Zeitweise legte der König beinahe täglich
einem Kranken die Hände auf, die von weit entfernt anreisten. |
Zurück zu den Wassermännern: Vom Wassermann erbat sich ein Kranker mit
einem Spruch Hilfe gegen die Gicht. Danach trinkt er von dem Wasser, das
entweder stromabwärts oder gegen den Strom dem Fluss entnommen wurde.
Doch
die Nixen und Wassermänner waren nicht nur hilfreich: Sieht man zum
Beispiel die Nixen im Tribächli des Schweizer Kantons Aargau sieht, bekommt
man einen Ausschlag. Und von den Brunnennixen wurde gesagt, dass sie Fieber
hervorrufen können.[38]
Wassermänner
können auch die Zukunft vorhersagen
Früher
glaubte man, dass Wassermänner auch das Wetter vorhersagen könnten. So ist
von einem See in Pommern überliefert, dass dort jedes Mal, bevor ein Sturm
herauf zog, ein König mit einer Feuerkrone auf dem Kopf, einer flammenden Rüstung
und einem glühenden Schwert in einem Boot über den See fuhr. Aus der
Steiermark wiederum gibt es die Legende, dass der Gesang der Wassernixen das
Zeichen für ein Gewitter war.
Erscheint
wiederum der Wassermann, deutet das auf einen Wolkenbruch hin.
Trocknen
die Wassernixen ihre Wäsche, wird sich das Wetter ändern.
Eine
andere Legende über den Wassermann kommt aus der Lausitz: Kommt der
Wassermann auf den Wochenmarkt, um Getreide zu kaufen und er bezahlt viel
Geld dafür, dann stehen teure Zeiten ins Haus. Verkauft er das Getreide
aber selbst und dieses ist billig, so fallen die Preise. Dasselbe wird über
die Wasserfrau und die Butter erzählt.
Aus
Freiburg gibt es eine Legende, nach der ein die Zukunft alljährlich in der
Neujahrsnacht von einem kleinen Mann vorhergesagt wird, der auf dem
Geisbrunnen am Schlossberg steht. Wenn er drei Ähren in seinen Händen hält,
wird das Jahr gut, hat er hingegen nichts in der Hand und schaut traurig,
stehen den Einwohnern schlechte Zeiten ins Haus[39].
Aus
den Niederlanden kommt die Legende, dass eine Nixe Fischern mit ihrem Gesang
auf einen Walfisch hindeutete. Auch gibt es die Sage von einer Wahrsagerin
im niederländischen Ypern, eine Stadt in Westflandern, die vor ihren
Prophezeiungen immer den Wassermann anrief. Dann drehte sie sich dreimal im
Kreis und wusste bei allen Fragen Bescheid.
Auch
das Ende der katholischen Religion und der Eucharistie wurde vorher gesagt
– und zwar von Meernixen, die einem Brunnen in Jaxthausen bei Heilbronn
entstiegen. Im Übrigen finden auf der Burg Jaxthausen alljährlich die „Götz
von Berlichingen“-Festspiele statt.[40]
Erscheint
ein Wassermann als Tier, beispielsweise als Hirsch, bedeutet das den Tod des
Landesherrn noch im selben Jahr. Als der Germanenkönig Ariovist in den
Jahren 58 bis 50 vor Christus seinen Kampf gegen Julius Cäsar führte,
holte er dazu den Rat von heiligen Frauen ein, die ihm, allein durch das
Ansehen der Flusswellen die Zukunft vorher gesagt haben. Das schreibt
Plutarch in seiner Cäsar-Biografie.
Der
oströmische Dichter und Historiker Agathias (geb. 536 in Myrina in
Kleinasien, gest. 582 in Konstantinopel) schreibt von einem Opfer der fränkischen
Bevölkerung an den Po, die wohl deshalb getätigt wurden, um die Wassermänner
friedlich zu stimmen. Diese Opfer wurden im Jahr 731 n. Chr. von Papst
Gregor III. für die germanischen Provinzen verboten.

Die
Rheintöchter warnen Hagen |
Die
Nixen kommen auch in der Nibelungensage vor – und zwar in Form der drei
Rheintöchter. Hagen befragt drei Meerfrauen, die in einer Quelle baden, über
sein Schicksal. Er nimmt ihnen die Kleider weg, um die Wahrheit zu
erpressen. Zuerst erzählen sie ihm eine Lüge. Als er ihnen die Kleider
aber wieder gibt, sagen sie Hagen, dass nur der Kaplan die Reise zu Hunnenkönig
Etzels Hof überleben wird. Um diese Weissagung zu verhindern, wirft Hagen
den Kaplan auf der Überfahrt ins Meer. Der kann jedoch an Land schwimmen
und erfüllt somit die Prophezeiung.[41]
|
Opfer an die Wassermänner
Um
Wassermänner friedlich zu stimmen und Unheil vorzubeugen, wurde dem Gewässer
oder dem Wassermann geopfert. Die Legenden sprechen hier von Opfern in Form
von Steinen, Speisen, Kleidern, Münzen und auch Tieren, die stellvertretend
für Menschenopfer standen. Manche Überlieferungen kennen aber auch
Menschenopfer. Die Opfer in Form von Blumen an Wassermänner wurden später
den Heiligen dargebracht.
Über
Menschenopfer berichtet Prokopios von Caesaria (500 bis 562), ein antiker
Historiker, dass die Franken während des Gotenkriegs (535 bis 552 n. Chr.)
die Leichname gotischer Frauen und Kinder als Opfer in den Po geworfen
haben.
Nach
den Historien von Agathias, ein oströmischer Dichter und Historiker (geb.
536 in Myrina bei Kleinasien, gest. 582 in Konstantinopel),
haben die früheren Germanen Flüsse, Pferde und Stiere geopfert, die
sie davor enthaupteten.
Aus
Salzburg stammt der Aberglaube, dass Jeder, der am Krimmler Wasserfall
vorbei geht, einen Stein hinein werfen muss, um die Wassermänner und Nixen
gewogen zu stimmen.
In
Sachsen-Anhalt gibt es den Fluss Bode, ein Nebenfluss der Saale. In diesen
Fluss warfen die Leute einmal pro Jahr einen schwarzen Hahn, ein Huhn, einen
Hund oder eine Katze. Taten sie das nicht, ertrank jemand.
Im
baden-württembergischen Vaihingen an der Enz und in Mittelstadt an der
Neckar musste den beiden Flüsse Neckar und Enz jedes Jahr an Christi
Himmelfahrt ein Bienenkorb, ein Schaf, ein Brotlaib und ein Mensch geopfert
werden.
Und
auch die Heiligen verlangten später Tieropfer: So mussten dem Heiligen
Johannes an seinem Tag drei weiße Hennen unter einer ihm geweihten Eiche
geopfert werden. Tat man dies nicht, blieb er unversöhnt.
In
Oberösterreich opferten die Müller am Tag des Heiligen St. Nikolaus alte
Kleider oder Essen, um das ganze Jahr über von den Wassermännern in
Frieden gelassen zu werden.
Es
gibt auch Überlieferungen, die darüber berichten, dass solche Opfer
weniger gut ausgingen: Ein Bauer aus Mähren wurde vom Wassermann verschont.
Als Dank dafür sollte er ihm jedes Monat ein schwarz-weiß geflecktes Kalb
opfern. Beim dritten Mal bemalte der Bauer ein weißes Kalb mit schwarzer
Farbe. Der Wassermann bemerkte dies natürlich sofort und holte den Bauern.
Der
Wassermann, der im brandenburgischen Koboldsee lebt, will von Menschen, die
an seinem See vorbei gehen, ein schwarzes Huhn und ein Brot haben.
Um
zu verhindern, dass jemand stirbt, hat man früher auch Schweine, schwarzen
Tauben und Brote in Mühlgräben geworfen. Es gab auch den Aberglauben, dass
man, wenn die Räder der Mühle pfiffen, den Rand eines Brotes hinein werfen
musste. Wenn das Pfeifen dann immer da war, musste man etwas Lebendes, wie
ein Huhn, eine Taube oder ein Ferkel opfern.
Den
Wassermännern wurden aber auch Menschen geopfert: So wollte ein See auf Rügen
jedes Jahr eine Jungfrau haben. Eine weitere Sage erzählt vom See in den
Vogesen im Elsass/Frankreich, dem gegen eine Seuche ab und zu ein kleiner
Junge geopfert wurde. Gibt man dem Wassermann sein versprochenes
Menschenopfer nicht, so holt er sich eines.
Menschenopfer
wurden auch dazu benutzt, um Dämme oder andere Wasserbauten stabil zu
halten. So wurde in einen Wehr der Unstrut, die ein Nebenfluss der Saale im
Thüringer Becken ist, ein Säugling mit eingemauert. Damit in Friesland ein
Deich hält, wurde einst ein Kind mit eingesenkt.
Auch
Überschwemmungen wurden durch Menschenopfer verhindert: In Pommern, einer
Region in Nordosten Deutschlands und Nordwesten Polens, überschwemmten die
Brunnen so lange das Land, bis die Menschen einen schwarzen Bullen, ein
schwarzes Kalb und ein Kind opferten. In einen anderen Brunnen in
West-Friesland musste das Blut eines dreijährigen Kindes ins Wasser
gemischt werden.
Aber
auch Beten half gegen Überschwemmungen und gegen Tod: So hatten es sich die
Bewohner, die in der Nähe des Pulvermaar in der Eifel in Rheinland-Pfalz
lebten, zur Angewohnheit gemacht, einmal pro Jahr singend und betend um den
See zu ziehen. Als sie das in einem Jahr ausließen, tobte der See – und
zwar so lange, bis ein Schäfer, der in der Nähe seine Schafe weidete, mit
seinem Stab betend und singend den See umkreiste. Danach war wieder Ruhe.
Im
Jahr 1641 wütete der Blautopf, eine Karstquelle bei Blaubeuren in der Schwäbischen
Alb (Baden-Württemberg). Daraufhin sandten die Einwohner eine Prozession
aus, die zwei vergoldete Becher hinein warf, um die Nixen zu besänftigen.
In den Walchensee, Ammersee und den See am Dreisesselberg (Bayern), wurden
zu eben diesem Zweck Goldringe geworfen.[42]
Können Wassermänner fern gehalten werden?
Ja,
das können sie. Nur wie man das anstellen soll, darüber gibt es
verschiedene Auffassungen: So soll man zweimal am Tag aufgebackenes Brot
essen oder auch nüchtern eine Scheibe aufgebackenes Brot essen. Nach einer
anderen Überlieferung muss das Brot nicht aufgebacken, sondern statt dessen
geweiht sein. Oder man isst einfach nur zweimal am Tag Brot oder Zwieback.
Gegen den Wassermann helfen soll auch, wenn man in neun Häusern gebackenes
Brot isst oder neunmal geweihtes Johannisbrot ins Gewand näht. Aber auch
etwas Mehlteig oder geweihtes Brot, das man in den Taschen bei sich trägt,
soll den Wassermann fern halten.
Auch der weiße Andorn und Oregano (altertümlich Dorant und Dosten) mag der Wassermann an einem Menschen nicht riechen.
Wächst der Majoran im Garten, so kann der Wassermann die frischgebackene Mutter nicht fort schleppen. Aus Friaul, einer Landschaft im Nordosten Italiens, kommt der Aberglaube, dass derjenige vom Wassermann verschont bleibt, der ein Edelweiß an der Brust trägt.
In Tschechien entwickelte man eine List, um den Wassermann zu fangen: Die Tschechen warfen ein rotes Band ins Wasser. Der von Natur aus neugierige Wassermann kam angeschwommen, um sich dieses Band genauer anzusehen. Als er dann zugriff, verwickelte er sich darin. Jetzt nahmen die Tschechen ein Halfter, um das geweihte Erlenrinde gewunden war und konnten so den in ein Pferd verwandelten Wassermann bezwingen. Statt der Erlenrinde wurde auch ein geweihter Strick verwendet.
In Schlesien wurde der Wassermann laut Überlieferung durch Ohrfeigen mit der linken Hand fort gejagt. Eine andere Methode war, mit der linken Hand ein Musikinstrument zu spielen und Kreuze zu schlagen.
Wurde man von ihm verfolgt, konnte man sich retten, wenn man über Bahngeleise sprang.
Auch Christliches spielte bei der Abwehr von Wassermännern eine große Rolle: So ist aus Schlesien bekannt, dass man, einen Kreuzknoten in seine Peitsche knoten und vor und auch hinter seinem Wagen ein Kreuz in die Luft „malen“ muss. Um vom Wassermann beim Baden nicht erwischt zu werden, muss man ein oder drei Kreuze machen. Auch ein Gebet oder ein einfaches „Jesu Maria“ soll ausreichen, um von ihm nicht geholt zu werden. Durch die Zeichen „C+M+B“, also „Christus mansionem benedicat“ wird auch das Haus vor dem Wassermann geschützt.
Der Wassermann mag auch kein Weihwasser, denn das verbrennt seine Haut. Sieht er einen Rosenkranz, sucht er das Weite. Töten kann man ihn durch einen am Palmsonntag geweihten Zweig vom deutschen Pistazienbaum (Pimpernussbaum). Wer am Johannistag den gesegneten Wein getrunken hat, dem kann der Wassermann nichts anhaben.
Wie
fängt man einen Wassermann?
Wassermänner
kann man der Legende nach fangen, indem man ihnen etwas zum essen und zum
trinken hinstellt und den betrunkenen Neck dann in ein Gewand, das man zuvor
mit Harz bestrichen hatte und Stiefel, die mit Pech überzogen waren,
hineinsteigen ließ.
Stieg
eine Wassernixe aus dem Wasser, konnte man sie mit einem geweihten
Rosenkranz fangen, während man dem Wassermann einen Baststrick mit drei
Knoten oder einen Strick, in den eine Schlinge gemacht war oder einen
Strohhalm, in dem drei Knoten waren, die der „Fänger“ mit der linken
Hand geknüpft hatte, überwarf.
Den
Wassermann soll man nicht wieder frei lassen, ohne ihm ein Geheimnis zu
entlocken. So soll ein Wassermann den Steirern den Erzberg geschenkt haben.
Dazu passt auch die skandinavische Überlieferung vom Wassermann Marmenill.
Der Wassermann gibt sich in der Gefangenschaft sehr schweigsam. Erst, als
der König seinen Hund schlägt, lacht er laut auf und gesteht, dass ihn
dieser Hund in der Zukunft das Leben retten wird. Als ihm der König
verspricht, ihn wieder ins Wasser zurück zu lassen, verrät er die ganze
Zukunft.
Tschechische
Legenden berichten darüber, dass der Wassermann getötet werden kann, wenn
er sich im Sonnenschein nach dem Regen am Ufer wärmt, da er in diesem
Moment keine Kräfte besitzt. Allerdings erhält er diese Kraft blitzschnell
wieder, wenn die Frösche zu quaken beginnen. Dem Glauben nach hat der
Wassermann am Land auch überhaupt keine Kräfte, während ihn sein Element,
das Wasser, unglaublich stark macht. Daher kommt auch die Überlieferung,
dass ein Wassermann, der in Gefangenschaft ist, sofort verschwindet, wenn
man ihm Wasser zu trinken gibt.[43]
Wassermänner in Theaterstücken
Dass
Wassermänner und Wassernixen später in Opern und Theater vorkamen, hat
vermutlich seinen Ursprung in den szenischen Darstellungen der Landbevölkerung.
So verkleideten sich junge Männer im Mansfelder Land oder an der Saale in
Sachsen-Anhalt mit grüner Kleidung und langen Haaren und spielten Szenen
nach.
Es
gab in Deutschland auch das Kinderspiel „Nix in der Grube“. Hier werden
der „Wassermann“ oder die „Wasserfrau“ in einer Grube oder in einem
Kreis, den die Kinder mit Wasser gelegt hatten, gefangen gehalten und von
den übrigen Kindern, die rundherum stehen, verspottet. Die
„Wasserwesen“ versuchen dann, eines der Kinder zu holen.
Übereinstimmung
der Legenden mit denen über andere Wesenheiten
Viele
dieser folkloristischen Legenden, die über die Wassermänner erzählt wird,
kommen tatsächlich aus der Vermischung mit anderen Sagen. So deuten die
Hilfsdienste, die die Wassermänner im Haushalt verrichten sollen, wie auch
das grüne Gewand und die rote Kappe auf Erzählungen über die Heinzelmännchen
hin.[44]
Auch die Erzählungen über die Wechselbälger, also die falschen Kinder,
wird sowohl den Wassermännern als auch den Zwergen angedichtet. Auch sollen
die Wassernixen des öfteren mit den „Weißen Frauen“ in Verbindung
gebracht worden sein. Weiße Frauen treten immer dann auf, wenn ein Unglück
kurz bevor steht. Sie warnen die Menschen.
Darüber
hinaus heißt es, dass die Nixen in der Saale eigentlich verzauberte
Menschen sein sollen, denen statt dessen der Wassermann einen Wechselbalg
hinterlassen hat.
Das
Interessante bei den überlieferten Sagen ist, dass die Fülle der
Geschichten von Osten nach Westen hin abnimmt. So sind aus Polen und
Tschechien mehr Legenden überliefert, von rheinischen Gebieten die
wenigsten. Deutsche, skandinavische und slawische Geschichten über Wassermänner
passen weitgehend zusammen. Auch in der Antike zeigen sich weitgehende Übereinstimmung
in der Auffassung über Wassermänner und Nixen.
Selbst
die Vulgata, der lateinische Bibeltext, der seit der Spätantike die bis
dahin älteren Übersetzungen der Bibel ablöste, und auch der Physiologus,
ein frühchristliches Kompendium der Tiersymbolik das im 2. Jahrhundert in
Alexandria entstanden ist, erwähnen die Sirenen. Darüber hinaus haben sich
die Nixen an Schiffen, Uhrengehäusen oder Wetterfahnen bis heute gehalten.
Zahlreiche Skulpturen oder Brunnen von Wassermännern und Nixen beweisen
noch heute eine lebendige Symbolik.
Warum
diese zahlreichen Legenden in einem so großen Umfang entstehen konnten,
liegt vor allem an der Bedeutung des Wassers für die Menschen: Es war einst
nicht nur der wichtigste Transportweg, sondern bot den Menschen auch
Nahrung. Die Mythen entstanden, weil der Mensch nach Erklärungen suchte,
warum zum Beispiel jemand im Wasser ertrank. Das Christentum spielte bei der
Bildung von Mythen eine geringe Rolle, wohl aber gibt es verschiedene
Abwehrzeremonien, die auf dem christlichem Glauben basieren.[45]
[1]
Wassergeister.
Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, S. 25745 (vgl. HWA Bd. 9, S.
128)
[2]
ebda S. 25746 (vgl. HWA Bd. 9, S. 128)
[3]
ebda.
S. 25749 (vgl. HWA Bd. 9, S. 130)
[4]
ebda.
S. 25750 (vgl. HWA Bd. 9, S. 131
[5]
ebda.
S. 25751(vgl. HWA Bd. 9, S. 132)
[6]
ebda.
S. 25752 (vgl. HWA Bd. 9, S. 132)
[7]
ebda
S. 25755 (vgl. HWA Bd. 9, S. 134)
[8]
ebda.
S. 25756 (vgl. HWA Bd. 9, S. 135
[9]
ebda.
S. 25770 (vgl. HWA Bd. 9, S. 143)
[10]
ebda
S. 25772 (vgl. HWA Bd. 9, S. 144-145)
[11]
ebda
S. 25773 (vgl. HWA Bd. 9, S. 145)
[12]
S.
25774 (vgl. HWA Bd. 9, S. 146)
[13]
ebda.
S. 25775, (vgl. HWA Bd. 9, S. 147)
[14]
ebda.
S. 25776 (vgl. HWA Bd. 9, S. 147)
[15]
ebda.
S. 25777(vgl. HWA Bd. 9, S. 148)
[16]
ebda.
S. 25778 (vgl. HWA Bd. 9, S. 149)
[17]
ebda. S.
25779 (vgl. HWA Bd. 9, S. 149)
[18]
ebda.
S. 25784 (vgl. HWA Bd. 9, S. 152)
[19]
ebda.
S. 25785 (vgl. HWA Bd. 9, S. 153
[20]
ebda.
S. 25786 (vgl. HWA Bd. 9, S. 154)
[21]
ebda S.
25787 (vgl. HWA Bd. 9, S. 155)
[22]
ebda.
S. 25789 (vgl. HWA Bd. 9, S. 156)
[23]
ebda.
S. 25790 (vgl. HWA Bd. 9, S. 156)
[24]
ebda. S. 25791 (vgl. HWA Bd.
9, S. 157)
[25]
ebda.
S. 25795 (vgl. HWA Bd. 9, S. 159)
[26]
ebda.
S. 25796 (vgl. HWA Bd. 9, S. 160-161)
[27]
eba.
S. 25797(vgl. HWA Bd. 9, S. 161
[28]
ein historisches Gebiet, das aus den belgischen Provinzen Antwerpen und
Brabant sowie dem im Süden der Niederlande gelegenen Provinz
Nordbrabant bestand.
[29] Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, S. 25798 (vgl. HWA Bd. 9, S. 162)
[30]
ebda. S. 25802 (vgl. HWA Bd. 9, S. 163-164)
[31]
eba.
S. 25802 (vgl. HWA Bd. 9, S. 164)
[32]
ebda. S. 25805 (vgl. HWA Bd. 9, S. 166-167)
[33]
ebda. S. 25810, (vgl. HWA Bd. 9, S. 169-170)
[34]
ebda S. 25812 (vgl. HWA Bd. 9, S. 170.171)
[35]
ebda S. 25814 (vgl. HWA Bd. 9, S. 172)
[36]
ebda. S. 25817 (vgl. HWA Bd.
9, S. 174)
[37]
ebda S. 25818 (vgl. HWA Bd. 9, S. 174-175)
[38]
ebda. S. 25819 (vgl. HWA Bd. 9, S. 175)
[39]
ebda S. 25821 (vgl. HWA Bd. 9, S. 176-177)
[40]
ebda. S. 25822 (vgl. HWA Bd. 9, S. 177)
[41]
ebda. S. 25823 (vgl. HWA Bd. 9, S. 177-178)
[42]
ebda. S. 25828 (vgl. HWA Bd. 9, S. 181)
[43]
ebda. S. 25832 (vgl. HWA Bd. 9, S. 183-184)
[44]
ebda. S. 25835 (vgl. HWA Bd. 9, S. 185-186)
[45]
ebda. S. 25841 (vgl. HWA Bd. 9, S. 189-190)