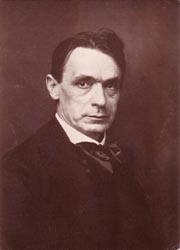Die Sylphen
Die Sylphen, deren anderer Name
auch Sylvani ist, sind die Elementarwesen der Luft. Nach den Überlieferungen
sollen Sylphen einen Körper besitzen, der jenen von Menschen ähnlich ist.
Auch können sie Kinder kriegen. Allerdings haben Sylphen im Gegensatz zu
den Menschen keine Seele. Namensgeber der Sylphen ist Paracelsus.
Als Sylphide wurde einst ein
Mensch mit einer sehr zarten Gestalt bezeichnet. Mitunter wurde so auch noch
bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein anmutiges Mädchen
bezeichnet. Dieser Begriff stammt vom Ballett „La Slyphide“, das am 12.
März 1832 im „Theatre de l’Academie Royale de Musique“ in Paris seine
Uraufführung hatte. Die Choreographie entwickelte Filippo Tanglioni (geb.
5. November 1777 in Mailand, gest. 11. Februar 1871 in Como), die Handlung
basiert auf der Novelle „Trilby“ des Franzosen Charles Nodier (geb. 29.
April 1780 in Besancon, gest. 27. Januar 1844 in Paris).
Die Geschichte spielt im
schottischen Hochland. Hier verliebt sich der Schäfer James, der kurz vor
seiner Hochzeit steht, in die Waldfee Sylphide. Er will aber nach wie vor
seine Braut heiraten. Als er und seine Effie vor dem Traualtar stehen, sind
die Ringe verschwunden. James folgt der Sylphide in den Wald, wo er erkennt,
dass die Liebe eines Sterblichen zu einer Unsterblichen niemals Erfüllung
finden wird. Er bittet die Hexe Old Madge um einen Zauber, um Sylphide von
sich fern zu halten. Diese gibt ihm einen magischen Schal. Doch statt sie zu
bannen, stirbt Sylphide. James jedoch muss erkennen, dass seine Braut Effie
einen anderen heiraten will und will daraufhin die Hexe töten. Diese jedoch
erkennt die Gefahr und bringt ihn davor mit einem Fluch um.
Ariel und Oberon
Zu den aus der Literatur
bekanntesten Luftwesen zählen Ariel und Oberon.
a)
Ariel/Uriel
Der Name Ariel kommt aus dem Hebräischen
und bedeutet „Feuerherd Gottes“ oder „Löwe Gottes“. Er entstammt
der koptischen Mythologie.[1]
Bei Ezechiel oder auch Hesekiel, einer Schrift des Alten Testaments, die um
zirka 560 bis 600 vor Christus in Babylonien entstand und von den
Prophezeiungen des Propheten Ezechiel handelt, bezeichnet der Name auch den
Altar im Tempel Jerusalems.

William Hamilton (1751-1801):
Prospero und Ariel |
Im Mittelalter mutierte Ariel
schließlich zu einem Wassergeist, während er aber in William Shakespeares
(1564 bis 1616) „Der Sturm“
(„The Tempest“) und Johann Wolfgang von Goethes „Faust“ (1749 bis
1832) (zwischen den Jahren 1772 bis 1775 geschrieben) als Luftgeist in die
Literatur einging. Ariel kommt bei Faust II als
Luftgeist vor. In der ersten Szene „Anmutige Gegend“ stellt er die
Verbindung zwischen dem ersten und dem zweiten Teil her. Er singt vom
„grimmigen Strauss des Herzens“ und von „bittren Pfeilen des
Vorwurfs“. Damit bezieht er sich auf das Ende vom Urfaust, in der Faust
sich einerseits mit seiner Liebe zu Gretchen und andererseits seinem
unstillbaren Wissensdurst auseinandersetzen muss. Die seelischen Schmerzen
kann er durch einen Heilschlaf überwinden. Dafür sind Elfen zuständig,
die ihm vergessen lassen und auch Heilung bringen. Darüber singt Ariel zu
Beginn des ersten Teiles und gibt so inhaltlich den Rahmen des kosmischen
Dramas wieder.
|
Uriel/Ariel oder Phanuel, wie er
auch bezeichnet wird, spielt auch in den jüdischen Überlieferungen eine
wichtige Rolle. Er ist einer der Erzengel, der als Herrscher über die
Sternenwelt und über das Heer der Engel wacht. Einst wurde er auch als
Erzengel verehrt – genau diese Verehrung wurde jedoch im Westen untersagt,
da sein Name in der Heiligen Schrift nicht explizit erwähnt wird. Nach den
Apokryphen und der Kabbalah soll er jedoch der Engel sein, der an den Toren
zur Unterwelt wacht und die Seelen der Verstorbenen vor Gott führt.
Auch im vierten Buch Esra, das zu
den alttestamentlichen Apokryphen zählt, die jedoch nur von den slawischen
und äthiopischen Orthodoxen als Bestandteil der biblischen Schriften
anerkannt werden, ist es Uriel, der Esra durch Himmel und Hölle begleitet.
Im ersten Teil des Buches Henoch
(Enoch), das nicht zu den biblischen Schriften zählt, ist Uriel neben
Gabriel, Raphael und Michael einer der vier Engel, die Gott über die
Untaten der bösen Engel auf der Erde informieren und die diese auch
bestrafen.
In den indischen Veden wird Uriel auch mit dem Feuergott Agni gleich gesetzt. Er ist es, der das in den Opferfeuern Verbrannte zu den Göttern bringt. Vom Aussehen her besitzt der Gott einen roten Körper, einen langen Bart und eine Flammenhülle. In den Händen hält er einen Dreizack, eine Flamme und einen Wassertopf. Er steht als Vermittler zwischen Menschen und Göttern. Sein Beiname ist „Vaishvanara“, was „der allen Männern gehörende“ bedeutet.
Agni wird im Hinduismus nicht mehr verehrt – seine Rolle beschränkt sich mittlerweile auf die des „Hüters des Südostens“.
b)
Oberon
Bei Oberon oder Alberich handelt
es sich um einen Elfen- beziehungsweise Zwergkönig in der germanischen
Mythologie. In der Sage der Merowinger[2]
ist es Alberich, der seinem ältesten Sohn Walbert dazu verhilft, dass die
Prinzessin von Konstantinopel seine Frau wird. Aus Alberich wird Auberon und
schließlich Oberon. Im 13. Jahrhundert taucht die Sage von „Huon de
Bordeaux“ auf. Oberon ist darin der Sohn von Julius Cäsar und der Fee
Morgue (Morgana). Er besitzt magische Fähigkeiten, mit denen er Huon hilft,
die Aufgaben, die ihm vom Karl dem Großen gestellt wurden, zu erledigen.
Oberon besitzt ein Horn, mit dem
er zu Hilfe gerufen werden kann, einen Trinkbecher, der sich dann mit Wein füllt,
wenn ein Mensch ohne Sünde ist und einen Zauber, mit dem er unter anderem
den Menschen ins Herz blicken und die Zukunft vorhersagen kann.
|
Die Oberon-Sage wurde später von
vielen Schriftstellern verwendet. Dazu zählen Geoffrey Chaucer (1343 bis
1400) oder Edmund Spenser (1552 bis 1599). Bei
William Shakespeares (23. April 1564 bis 23. April 1616,
Stratford-upon-Avon) „Sommernachtstraum“ tritt Oberon als Gatte der
Titania in Erscheinung. Diesen Stoff verwendete wiederum der englische
Komponist Henry Purcell (um 1695 in Westminster bis 1659 in London) für
sein Werk „The Fairy Queen“ und später der englische Dirigent,
Komponist und Pianist Benjamin Britten (22. November 1913 in Lowestoft bis
4. Dezember 1976 in Aldeburgh) für seinen „A Midsummer Night’s Dream). Auch Johann Wolfgang von Goethe
bediente sich für seinen „Faust I“ bei Shakespeare: Hier wird die
Goldene Hochzeit zwischen Oberon und der Elfenkönigin Titania beschrieben.
Der deutsche Dichter Christoph Martin Wieland (geb. 5. September 1773 bei
Laupheim gest. 20. Januar 1813 in Weimar) verwendete Oberon für sein
gleichnamiges Epos, nach dem der Historiker und Dramatiker James Robinson
Planché (geb. 27. September 1796 in
Picadilly, London, gest. 30. Mai 1880 in Chelsea, London) für den
deutschen Komponisten Carl Maria von Weber (geb. 19. November 1786 in
Eutin/Schleswig Holstein, gest. 5. Juni 1826 in London) die Oper
„Oberon“ geschrieben hatte. Wielands
Oberon (Ein Gedicht in vierzehn Gesängen - 1. Fassung 1780, 2. Fassung
1784) wurde auch als Vorlage für Paul Wranitzkys Oper Oberon verwendet, die
1789 in Wien uraufgeführt wurde. Die Motive wurden wiederum von Wolfgang
Amadeus Mozart als eine von vielen Vorlagen für seine Oper „Die Zauberflöte“
verwendet.
|
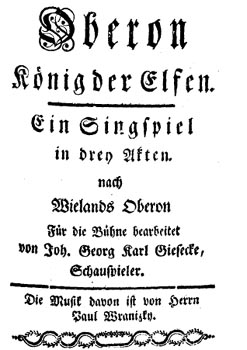 |
Später
taucht er als Elfenkönig in den Sagen um des König Artus sowie im
altdeutschen Heldenepos „Ornit“ auf.
Oberon kommt als Alberich aber
auch in der Nibelungensage vor. Hier ist er Hüter des legendären
Nibelungenschatzes, den er mit Hilfe einer Tarnkappe unsichtbar machen kann.
Siegfried gelingt es, diese Kappe von ihm zu stehlen und kommt so an den
Schatz.
In Richard Wagners (1813 bis
1883) Werk „Der Ring des Nibelungen“ tritt Alberich als tyrannischer
Zwergenkönig aus dem Geschlecht der Schwarzalben[3]
in Erscheinung.
Als im Jahr 1787 beim Uranus ein
Mond entdeckt wurde, erhielt dieser den Namen Oberon.
Die
Welt der Sylphen nach Erhard Bäzner
In den Sylphen, den Wesen der Luft, die Bäzner auch Elfen nennt, sieht er ein Zwischenglied zwischen den niederen Naturgeistern und jenen der höheren Astralwelt. Er schreibt ihnen größere Fähigkeiten als den Gnomen, Nixen, Salamandern und Sturmgeistern zu.
Gestaltung und Klassifizierung:
Die Sylphen werden den am Menschen am Ähnlichsten geschildert. Sie sollen außerdem noch unglaublich schön sein. Sie sind laut Bäzner geschlechtsneutral und kinderlos wie die Nixen, besitzen aber weibliche Körper. Ihr Aussehen ist jugendlich, ähnlich dem erwachsener Mädchen. Die Hautfarbe ist Blütenrosa und Weiß. Die Augenfarbe ist Himmelblau, die Haare sind bei Sylphen der ersten Klasse Lichtblond, Dunkelblond bei jenen der zweiten Klasse, Schwarzbraun oder Braun bei Sylphen der dritten. Sie reichen ihnen bis zum Rücken.
Die Körpergröße der Sylphen
richtet sich nicht nur nach der Klassenzugehörigkeit, sondern sie auch nach
der Gegend, in der sie sich aufhalten.
Bei der ersten Klasse beträgt
sie zwischen 150 und 170 Zentimeter, 135 bis 150 bei jenen der zweiten
Klasse, 120 bis 135 Zentimeter ist sie bei der dritten Klasse. Die schönsten
und auch kleinsten Sylphen findet man in flachen Landschaften, größer und
auch kräftiger sind die der Gebirgsgegenden am kräftigsten und größten
sind die, die über dem Meer schweben. Auch sind Gesichtzüge von Letzteren
nicht ganz so anmutig wie die ihrer Schwestern. Sylphen besitzen die Fähigkeit,
ihren aus Astralmaterie geformten Körper mit Ätherstoff nach Belieben zu
verlängern oder auch zu verkleinern. Ihre Aura ist Rosa und umhüllt die
normale Sylphe, noch prächtiger ist die der Führerinnen. Laut Bäzner kann
eine Sylphe ungefähr 50 bis 70 Jahre alt werden.
Bekleidung
Die Bekleidung besteht aus einem durchsichtigen Schleier, der mit Gold- und Silberstickereien verziert ist. Seine Farbe richtet sich nach Klasse und Gegend, kann also Blütenweiß über Himmelblau bis hin zu Grün und Rot sein. Die Führerinnen der Sylphen tragen zusätzlich noch ein Schmuckstück, durch das der Schleier zusammen gehalten wird.
Um das Haar haben sie ein Band,
das mit ornamentalen Stickmustern verziert ist. Der Kopfschmuck – Gelb,
Rosa, Lila, Blau, Grün oder Rot – dient zugleich als Merkmal der
Klassenzugehörigkeit – in seiner Mitte funkelt ein heller Stein. Die
Sylphenführerin hat einen in allen Farben leuchtenden diamantähnlichen
Schmuck, sie trägt auch eine Perlenkette um ihren Hals. Der Schmuck wird
aus verdichteter Astralmaterie hergestellt. Vom Kopf aus strahlt ein
Sechsstern, der bei jeder Sylphe andere Farbnuancierungen aufweist. Dieser
erhellt laut Bäzner nicht nur astral den Wohnraum, den die Sylphe betritt,
sondern auch das Haus ist ringsherum plötzlich hell erleuchtet.
Wohnraum
Eigentlich leben Sylphen ja
hauptsächlich in der Luft – jedoch können sie in jedem anderen Element
bewegen. Bäzner bezeichnet sie als die gewandtesten und weisesten unter den
Naturgeistern, denen auch Gnome und Nixen gehorchen. Selbst Salamander haben
keinen negativen Einfluss auf die Sylphen. Sie stellen sozusagen die „höchste
Stufe der Veredelung“ dar, deshalb stehen ihnen als einzige unter den
Elementarwesen auch andere Ebenen, wie beispielsweise das Astralreich offen.
Sie leben im Luftbereich aller Erdteile - in Mitteleuropa dort, wo es die
meisten Gnome gibt. In der Nord- und Ostsee sind sie die ganze Nacht über
dem Wasser zu finden. Während des Tages findet man die Sylphen in der Erde,
bevorzugt unter Felsengebirgen, Bergseen, Strömen, Flüssen, unter Meeresdünen,
dichten Wäldern, schönen Gärten- und Parkanlagen. Am Tag sind sie laut Bäzner
seltener an der Oberfläche zu sehen und dann auch meistens nur im Frühling,
wo sie Waldlichtungen aufsuchen.
Nachts dagegen findet man sie in
Gebirgstälern, Wäldern, Wiesen, Hainen oder Blumenanlagen. Sie tanzen und
singen unter der Leitung ihrer Führerin. Sie lieben die Nähe der Kinder,
mit denen sie auch ab und zu spielen. Mit Tieren spielen sie hingegen nicht.
Sie mögen auch keine brutalen oder habgierigen Menschen und meiden daher
Gefängnisse, Kneipen oder Schlachthäuser. Auch hassen sie niedere
Gedanken.
Auch in sumpfigen oder nieder
gelegenen Gegenden sind die Sylphen nicht zu finden, genau so wenig wie in
hohen Luftregionen, wo andere Wesenheiten leben.
Auf Grund ihrer zarten Haut müssen
sie grelles Sonnenlicht und starken Sturm meiden. In so einem Fall fliehen
sie dann schnell unter die Erde. Sylphen sind nicht so sesshaft wie Gnome
und Nixen, sondern wechseln auch öfter ihren Aufenthaltsort.
Jeder Gruppe der Sylphen hat eine bestimmtes Arbeitsgebiet, das ihnen von einer der Sylphenführerinnen zugewiesen wird. Diese Königin wird von einem Deva unterwiesen. Im Winter werden die Sylphen laut Bäzner unter den Bergen und Hügeln geschult, in der warmen Jahreszeit auf Wiesen oder Wäldern.
Wie die Gnome und Nixen werden sie in der Pflanzenkunde, Chemie, Psychologie unterrichtet und lernen auch, wie sie Menschen und Tieren beistehen können. Allein schon ihre astrale Natur erlaubt es ihnen, eine weitaus umfangreichere Tätigkeit zu entfalten wie den Gnomen. So können sie zum Bespiel die Formen der Mineralien und Edelsteine vervollkommnen, indem sie die Schwingungen der Materie beschleunigen.
Auf Grund ihrer aurischen Strahlkraft, wie Bäzner dies nennt, wird nicht nur der Wachstumsverlauf im Bereich der Mineralien gestärkt, sondern auch der Wuchs der Pflanzen – auch Mensch und Tier können daraus Nutzen ziehen. So können Sylphen ätherisch-elektrische Schwingungen in die Pflanzen und Früchte leiten, können sich zum Beispiel in eine Elfe verwandeln und eine Blütenknospe anhauchen oder dann wieder riesenhaft werden und einen Obstbaum umarmen. Bei ihrer Tätigkeit werden sie von höheren Wesen geleitet.
Melancholisch und traurig werden die Sylphen im Herbst, wenn alles verwelkt und verblüht. Sie leiden auch, wenn einem ihrer Schützlinge Leid zugefügt wird.
Ab und zu müssen sie auch mit Nixen und Gnomen zusammenarbeiten, um das Leben von Pflanzen und Tieren zu fördern. Auch wenn Tiere oder Menschen in Not sind, sind es oft die Sylphen, die die Erd- und Wasserwesen dazu bringen, ihnen zu helfen. Ständig sind sie laut Bäzner um den Menschen bemüht. Sie sind ständig präsent, können sie die gute Eigenschaften wie Tugend verstärken. Niedere Wesen hüten sich vor den Sylphen, da sie durch deren hohe Schwingungen aufgelöst werden könnten.
Besonders gerne sorgen sich diese Wesenheiten jedoch um die Kinder. Sie beschützen sie und dienen quasi als Schutzengel der Kleinen. Auch werdende Mütter schirmen die Sylphen gegen negative Einflüsse ab. Sylphen leisten laut Bäzner aber auch passive Sterbehilfe, indem sie Sterbende mit schönen Gesängen beruhigen, böse Wesenheiten von ihnen fern halten und helfende Wesen herbei holen.
Sylphen geben aber auch Unterricht: Sie verbinden sich im Schlaf mit dem Ätherkörper der Menschen und bringen ihnen schöne Träume.
Die Feste der Sylphen
Laut Bäzner sollen die Sylphen Feste und Bräuche der Menschen nachahmen, denen sie nahe stehen.
Das Hauptfest der Sylphen fällt in die erste Hälfte des Februars. Es wird ganz nach menschlichen Bräuchen gefeiert, je nachdem, was die Sylphen den Menschen abgeschaut haben.
Das zweite große Fest ist an Pfingsten – auch hier wird das geboten, was sich die Sylphen abgeschaut haben.
Die Sonnenwende feiern sie mit Gesängen, Spielen und Tänzen.
Für Erhard Bäzner stellen die Sylphen das Symbol der Reinheit, Schönheit, Güte und Liebe und des Friedens dar. Sie sind von Harmonie und Glückseligkeit erfüllt.
aus Heines Buch „Die
Elementargeister“, veröffentlicht 1837
Elfen und Totenbräute
Von den Zwergen, den Erdgeistern, sind genau zu unterscheiden die Elfen, die Luftgeister, die auch in Frankreich mehr bekannt sind und die besonders in englischen Gedichten so anmuthig gefeyert werden. Wenn die Elfen nicht ihrer Natur nach unsterblich wären, so würden sie es schon allein durch Shakespear geworden seyn. Sie leben ewig im Sommernachtstraum der Poesie.
Der Glaube an Elfen ist nach meinem Bedünken viel mehr celtischen als scandinavischen Ursprungs. Daher mehr Elfensagen im westlichen Norden als im östlichen. In Deutschland weiß man wenig von Elfen und alles ist da nur matter Nachklang von bretanischen Sagen, wie z. B. Wielands Oberon. Was das Volk in Deutschland Elfen oder Elben nennt, sind die unheimlichen Geburten der Hexen, die mit dem Bösen gebuhlt.
Die eigentlichen Elfensagen sind heimisch in Irland und Nordfrankreich; indem sie von hier hinabklingen bis zur Provence vermischen sie sich mit dem Feenglauben des Morgenlands. Aus solcher Vermischung erblühen nun die vortrefflichen Lais vom Grafen Lanval, dem die schöne Fee ihre Gunst schenkt unter dem Beding, daß er sein Glück verschweige. Als aber König Arthus, bey einem Festgelage zu Karduel, seine Königinn Genevra für die schönste Frau der Welt erklärte, da konnte Graf Lanval nicht länger schweigen; er sprach, und sein Glück war, wenigstens auf Erden, zu Ende. Nicht viel besser ergeht es dem Ritter Grüeland; auch er kann sein Liebesglück nicht verschweigen, die geliebte Fee verschwindet, und auf seinem Roß Gedefer reitet er lange vergebens, um sie zu suchen. Aber in dem Feenland Avalun finden die unglücklichen Ritter ihre Geliebten wieder. Hier können Graf Lanval und Herr Grüeland so viel schwatzen, als nur ihr Herz gelüstet. Hier kann auch Ogier der Däne von seinen Heldenfahrten ausruhen in den Armen seiner Morgane. Ihr Franzosen kennt sie alle, diese Geschichten. Ihr kennt Avalun, aber der Perser kennt es auch, und er nennt es Ginnistan. Es ist das Land der Poesie.
Das Aeußere der Elfen und ihr Weben und Treiben ist Euch ebenfalls ziemlich bekannt. Spensers Elfenköniginn ist längst zu Euch herübergeflogen aus England. Wer kennt nicht Titania? Wessen Hirn ist so dick, daß es nicht manchmal das heitre Geklinge ihres Luftzugs vernimmt? Ist es aber wahr, daß es ein Vorzeichen des Todes, wenn man diese Elfenköniginn mit leiblichen Augen erblickt und gar einen freundlichen Gruß von ihr empfängt? Ich möchte dieses gern genau wissen, denn:
In dem Wald, im Mondenscheine,
Sah ich jüngst die Elfen
reuten;
Ihre Hörner hört' ich
klingen,
Ihre Glöckchen hört' ich läuten.
Ihre weißen Rößlein trugen Güldnes
Hirschgeweih und flogen
Rasch dahin, wie Schwanenzüge
Kam es durch die Luft gezogen.
Lächelnd nickte mir die
Kön'ginn,
Lächelnd im Vorüberreuten.
Galt das meiner neuen Liebe,
Oder soll es Tod bedeuten?
In den dänischen Volksliedern giebt es zwey Elfensagen, die den Charakter dieser Luftgeister am treuesten zur Anschauung bringen. Das eine Lied erzählt von dem Traumgesichte eines jungen Fants, der sich auf Elvershöh niedergelegt hatte und allmählig eingeschlummert war. Er träumt, er stände auf seinem Schwerte gestützt, während die Elfen im Kreise um ihn her tanzen und durch Liebkosen und Versprechung ihn verlocken wollen, an ihrem Reigen Theil zunehmen. Eine von den Elfen kömmt an ihn heran und, streichelt ihm die Wange und flüstert: tanze mit uns, schöner Knabe, und das Süßeste was nur immer dein Herz gelüstet wollen wir dir singen. Und da beginnt auch ein Gesang von so bezwingender Liebeslust, daß der reißende Strom, dessen Wasser sonst wildbrausend dahin fließt, plötzlich still steht und in der ruhigen Fluth die Fischlein hervortauchen und vergnügt mit ihren Schwänzlein spielen. Eine andere Elfe flüstert: tanze mit uns, schöner Knabe, und wir wollen dir Runensprüche lehren, womit du den Bär und den wilden Eber besiegen kannst, so wie auch den Drachen, der das Gold hütet; sein Gold soll dir anheimfallen. Der junge Fant widersteht jedoch allen diesen Lockungen, und die erzürnten Jungfrauen drohen endlich ihm den kalten Tod ins Herz zu bohren. Schon zücken sie ihre scharfen Messer, da, zum Glücke, kräht der Hahn, und der Träumer erwacht mit heiler Haut.
Das andere Gedicht ist minder lustig gehalten, die Erscheinung der Elfen findet nicht im Traume, sondern in der Wirklichkeit statt, und ihr schauerlich anmuthiges Wesen tritt uns desto schärfer entgegen. Es ist das Lied von dem Herrn Oluf, der Abends spät ausreutet, um seine Hochzeitgäste zu entbiethen. Der Refrain ist immer: Aber das Tanzen geht so schnell durch den Wald. Man glaubt unheimlich lüsterne Melodieen zu hören und zwischendrein ein Kichern und Wispern, wie von muthwilligen Mädchen. Herr Oluf sieht endlich wie vier, fünf, ja noch mehre Jungfrauen hervortanzen und Erlkönigstochter die Hand nach ihm ausstreckt. Sie bittet ihn zärtlichst in den Kreis einzutreten und mit ihr zu tanzen. Der Ritter aber will nicht tanzen und sagt zu seiner Entschuldigung: morgen ist mein Hochzeitstag. Da werden ihm nun gar verführerische Geschenke angeboten; jedoch, weder die Widderhautsstiefel, die So gut am Beine sitzen würden, noch die güldenen Sporen, die man so hübsch daran schnallen kann, noch das weißseidne Hemd, das die Elfenköniginn selber mit Mondschein gebleicht hat, nicht mahl die silberne Schärpe, die man ihm ebenfalls so kostbar anrühmt, nichts kann ihn bestimmen, in den Elfenreigen einzutreten und mit zu tanzen. Seine beständige Entschuldigung ist: morgen ist mein Hochzeitstag. Da, freylich, verlieren die Elfen endlich die Geduld, sie geben ihm einen Schlag aufs Herz, wie er ihn noch nie empfunden, und heben den zu Boden gesunkenen Ritter wieder auf sein Roß, und sagen spöttisch: so reite denn heim zu deiner Braut. Ach! als er auf seine Burg zurückkehrte, da waren seine Wangen sehr blaß und sein Leib sehr krank, und als am Morgen früh die Braut ankam mit der Hochzeitschaar, mit Sang und Klang, da war Herr Oluf ein stiller Mann; denn er lag todt unter dem rothen Bahrtuch.
"Aber das Tanzen geht hin so schnell durch den Wald."
Der Tanz ist charakteristisch bey den Luftgeistern; sie sind zu ätherischer Natur, als daß sie prosaisch gewöhnlichen Ganges, wie wir, über diese Erde wandeln sollten. Indessen, so zart sie auch sind,' so lassen doch ihre Füßchen einige Spuren zurück auf den Rasenplätzen, wo sie ihre nächtlichen Reigen gehalten. Es sind eingedrückte Kreise, denen das Volk den Namen Elfenringe gegeben.
In einem Theile Oestreichs giebt es eine Sage, die mit den vorhergehenden eine gewisse Aehnlichkeit biethet, obgleich sie ursprünglich slavisch ist. Es ist die Sage von den gespenstischen Tänzerinnen, die dort unter dem Namen "die Willis" bekannt sind. Die Willis sind Bräute, die vor der Hochzeit gestorben sind. Die armen jungen Geschöpfe können nicht im Grabe ruhig liegen, in ihren todten Herzen, in ihren todten Füßen blieb noch jene Tanzlust, die sie im Leben nicht befriedigen konnten, und um Mitternacht steigen sie hervor, versammeln sich truppenweis an den Heerstraßen, und Wehe! dem jungen Menschen, der ihnen da begegnet. Er muß mit ihnen tanzen, sie umschlingen ihn mit ungezügelter Tobsucht, und er tanzt mit ihnen, ohne Ruh und Rast, bis er todt niederfällt. Geschmückt mit ihren Hochzeitkleidern, Blumenkronen und flatternde Bänder auf den Häuptern, funkelnde Ringe an den Fingern, tanzen die Willis im Mondglanz, eben so wie die Elfen. Ihr Antlitz, obgleich schneeweiß, ist jugendlich schön, sie lachen so schauerlich heiter, so frevelhaft liebenswürdig, sie nicken so geheinmißvoll lüstern, so verheißend, diese todten Bacchantinnen sind unwiderstehlich.
Das Volk, wenn es blühende Bräute sterben sah, konnte sich nie überreden, daß Jugend und Schönheit so jähling gänzlich der schwatzen Vernichtung anheimfallen, und leicht entstand der Glaube, daß die Braut noch nach dem Tode die entbehrten Freuden sucht.
Dieses erinnert uns an eins der schönsten Gedichte Goethes, die Braut von Korinth, -womit das französische Publikum, durch Frau von Stael, schon längst Bekanntschaft gemacht hat. Das Thema dieses Gedichtes ist uralt und verliert sich hoch hinauf in die Schauernisse der thessalischen Mährchen. Aelian erzählt davon und Aehnliches berichtet Philostrates im Leben des Apollonius von Thiane. Es ist die fatale Hochzeitgeschichte wo die Braut eine Lamia ist.
Es ist den Volkssagen eigenthümlich, daß ihre furchtbarsten Katastrophen gewöhnlich bey Hochzeitfesten ausbrecheri. Das plötzlich eintretende Schreckniß kontrastirt dann desto grausig schroffer mit der heiteren Umgebung, mit der Vorbereitung zur Freude, mit der lustigen Musik. Solange der Rand des Bechers noch nicht die Lippen berührt, kann der kostbare Trank noch immer verschüttet werden. Ein düsterer Hochzeitgast kann eintreten, den niemand gebeten hat und den doch keiner den Muth hat fortzuweisen. Er sagt der Braut ein Wort ins Ohr und sie erbleicht. Er giebt dem Bräutigam einen leisen Wink, und dieser folgt ihm aus dem Saale, wandelt mit ihm weit hinaus in die wehende Nacht, und kehrt nimmermehr heim. Gewöhnlich ist es ein früheres Liebesversprechen, weßhalb plötzlich eine kalte Geisterhand die Braut und den Bräutigam trennt. Als Herr Peter von Staufenberg beim Hochzeitmahle saß, und zufällig; aufwärts schaute, erblickte er einen kleinen weißen Fuß, der durch die Saalesdecke hervortrat. Er erkannte den Fuß jener Nixe womit er früher im zärtlichsten Liebesbündnisse gestanden, und an diesem Wahrzeichen merkte er wohl, daß er durch seine Treulosigkeit das Leben verwirkt. Er schickt zum Beichtiger, läßt sich das Abendmahl reichen und bereitet sich zum Tode. Von dieser Geschichte wird in deutschen Landen noch viel gesagt und gesungen. Es heißt auch, die beleidigte Nixe habe den ungetreuen Ritter unsichtbar umarmt und in dieser Umarmung gewürgt. Tief gerührt werden die Frauen bey dieser tragischen Erzählung. Aber unsere jungen Freygeister lächeln darüber spöttisch und wollen nimmermehr glauben, daß die Nixen so gefährlich sind. Sie werden späterhin ihre Ungläubigkeit bitter bereuen.
Was sagt Rudolf Steiner über die Sylphen?
|
Rudolf Steiner |
Laut Steiner stammen die Sylphen
von den Angeloi, also den Engeln ab. Ihre Aufgaben sind, die Pflanzen mit
Lichtäther zu versorgen. Wenn die Pflanze verwelkt, wird die Form der
Urpflanze an die Erde abgegeben und dort wiederum von den Gnomen bewahrt. Nach Steiner fühlen sich die
Sylphen zu allen Bewegungen des Luftraums hingezogen, für den sie ein
feines Gespür besitzen. So halten sie sich überall dort auf, wo das Tier-
und Pflanzenreich miteinander in Berührung kommen, also zum Bespiel dort,
wo Bienen um die Blüten herumschwirren. Außerhalb der normalen Pflanzenwelt können die kleinen Sylphen zu riesigen Wesen heranwachsen. |
Es gibt laut Steiner auch böse
Sylphen, die das, was eigentlich nur in die oberen Luft- und Wärmeregionen
gehört, auf die Erde hinunter tragen, wodurch wiederum Pflanzengift, wie
Belladonna entstehen. Als Beweis dafür wirft Steiner die Frage auf, warum
Belladonna, eine Pflanze, die seiner Meinung nach „von der Sylphe geküsst“
wurde, auf erdgebundene Menschen und auch manche Tiere tödlich wirkt, während
Vögel, die ja der Luft angehören, das Gift ohne Probleme vertragen.
Die guten Sylphen halten sich
laut Steiner von Menschen und Tieren fern.
Der Mensch kann die Sylphen nur
im Aufwachtraum erkennen.
Alben, Elben, Sturmgeister,
Devas – die Verwandtschaft der Sylphen
Alben, Devas, Elfen, Feen oder
Sturmgeister – sie alle gehören zur Gattung der Sylphen. Während die
Luftgeister allgemein friedliche Wesenheiten sind, die Tiere und Pflanzen
umsorgen und den Luftraum überwachen, sind die Sturmgeister wilde Gesellen,
die alles nur zerstören wollen. Der Mensch merkt ihre Anwesenheit am besten
in Stürmen, in denen sich die Sturmgeister austoben können. Nicht selten
hinterlassen sie eine Spur der Verwüstung.
1. Die Elfen oder Alben
Als Elfen oder auch Alben oder
Elben werden Fabelwesen bezeichnet, die in der Mythologie und in der
Literatur vorkommen.
Sie sind Naturwesen, die ursprünglich
aus der nordischen Mythologie stammen. Altnordisch bezeichnet man die Elfen
als álf, im Althochdeutschen sind sie als alb bekannt, im Dänischen
heißen sie elve, was wiederum mit dem Lateinischen albus, was
„weiß“ bedeutet, verwandt ist. Wurde noch vor einiger Zeit der Ausdruck
„alb“ für Elfe sehr oft gebraucht, so ist dieser mittlerweile von der
englischen Elfe verdrängt worden.
Die mythologische Abstammung der Elfen
Die nordischen Elben tauchen das
erste Mal in der Prosa-Edda oder auch jüngere Edda genannt, auf, die um 13.
Jahrhundert verfasst wurde. Sie sollen zum Göttergeschlecht der Asen, dem jüngeren
Göttergeschlecht, zählen. Das ältere Geschlecht sind die Wanen.
Laut der Prosa oder Snorra-Edda[4]
gibt es Schwarz- und Lichtalben. So erzählt die Edda, dass die Schwarzalben
schwarz wie Pech sind, unter der Erde leben, die Lichtalben hingegen leben
oberirdisch und sind schön. Die Alben sollen auch sehr fruchtbar sein, da
sie mit dem Fruchtbarkeitsgott Freyr in Verbindung stehen.
Die bösartige Form der Licht-
und Schwarzalben sind die Dunkelalben, die erst später auftauchen.
Die Wohnung der Lichtelben ist
laut der Prosa-Edda Alfheimr. Es ist aber überliefert, dass in Alfheimr der
Gott Freyr wohnen soll.
Ungeklärt ist, ob die Zwerge
Verwandte der Alben sind. Da „álfr“ ein Wortteil einiger Zwergennamen
ist, beispielsweise Àlfr oder Gandálfr, sehen einige Autoren hier eine
Verbindung. Der berühmteste Zwerg ist Alberich aus der Nibelungensage. Auch
stammt das englische Wort für Zwerg „Dwarf“, vom Ausdruck
Dwarftalf ab, was wiederum für Schwarzalb steht.
Auch heute findet man den
„Alb“ noch im Sprachgebrauch – nämlich im Albtraum und im Hexenschuss,
das vom Ausdruck Albenschuss abstammt.
Sagen über Alben
Über die Alben es viel mehr positive Legenden als negative. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Wielandsage über „Wieland den Schmied“. Er wird als Anführer der Alben bezeichnet. Inhaltlich dreht sich die Sage um Wieland und den König Nidung, der in der Edda auch Nidud genannt wird. Nidung lässt Wieland die Sehnen durchschneiden und der Schmied wird dadurch gelähmt. Seine Rache jedoch ist grausam: Er tötet die Söhne des Königs, macht aus deren Gehirnen goldene Trinkschalen und zeugt mit seiner Tochter ein Kind.
Diese Sage gibt es in zwei
unterschiedlichen Versionen – einerseits die Thidrekssaga, andererseits im
Völundlied aus der Liederedda. Der Kern der Sagen ist jedoch derselbe. Das
Schwert Mimung, das Wieland schmiedet, kommt jedoch nur in der Thidrekssaga
vor.
Daneben gibt es auch die Sage über
König Harald Harfagre, auch Harald I. oder König Schönhaar genannt. Er
lebte zirka von 852 bis 933 und war der erste große König Norwegens. Von
diesem König sind außer Sagen und den so genannten Skaldengedichte nur
wenig überliefert. Von den Skaldengedichten gibt es elf Gedichte, die in 50
Strophen überliefert sind. In einer dieser Sagen kommen einige Namen vor,
die von den Alben abgeleitet sind – zum Beispiel Alfr, Alfhild oder
Alfgeirr.
Die etymologische Herkunft des Wortes Alb
Es gibt zwei Theorien für die Herkunft des Wortes „Alb“: Einerseits vom Lateinischen albus, was „weiß“ bedeutet und vom indogermanischen „albh“ abstammt, was glänzen, weiß sein, heißt.
Andererseits könnte der albus
auch vom altindogermanischen rbhu kommen, was übersetzt „Künstler“
oder „kunstvoll“ bedeutet.
Bei der Bezeichnung „alb“ könnte
es sich auch um einen Hinweis auf „Berg“ handeln. Ein Beispiel aus der
Gegenwart ist die „Schwäbische Alb“.
Alfablót
Alfablót wurde ein Opfer an die
Elfen genannt, von dem aber so gut wie nichts überliefert ist.
Wahrscheinlich handelte es sich dabei um ein Fruchtbarkeitsopfer. Es gibt
einen Hinweis von Sigvat Torddson (geb. 995), der ein Dichter im Gefolge von
König Olav dem Heiligen[5]
war. Eine Skalde (Dichtung) handelt davon, dass der König an einem Hof
kommt, aber die Stube nicht betreten darf, da gerade das Elfenopfer
abgehalten wird.
Die
Alben im Mittelalter
Im Spätmittelalter wurden aus
den Alben böse Zwerge, die auch mit dem Incubus[6]
oder Succubus gleich gesetzt wurden.

Johann Heinrich Füssli:
"Nachtmahr", 1802, |
Ein anderer Aberglaube von Alben berichtet, dass sich diese nachts auf die Brust den Schlafenden legen und ihm die Lebensenergie aussaugen. Der Schlafende bekommt dann keine Luft mehr und leidet unter Atemnot oder Albträumen. Der Alb kann aber auch in den Körper des Menschen eindringen und saugt ihm dort das Blut aus. Weniger blutrünstig ist seine Vorliebe für Kuh- oder Muttermilch. Die Alben wurden durch diese Legenden zum Gegenteil von Feen, die später als Lichtalben bezeichnet werden. Erst ab dem 18. Jahrhundert wurde der Alb immer mehr zur Fee, die den Menschen gut gesonnen war. Davor gab es verschiedene Ansichten über Alben und die bedeuteten oft nichts Gutes für den Menschen.
|
Die verschiedenen
Bezeichnungen für den Alb
Der Ausdruck Alb wurde vor
allem in der Mitte Deutschlands, Hinterpommern (zwischen der Oder und den
Pommerellen gelegen) und Siebenbürgen (ein Teil Polens) gebraucht. In
Norddeutschland, den Niederlanden und Ostpreußen hieß der Alb hingegen
Mahr, Nachtmahr oder Mahrt. In Südostdeutschland, Österreich und der
Schweiz kennt man den Schrättele oder Schrat. Nebenformen waren Schrättlig
Schrätzel, Schrecksel,
Schreckle, Schrätzmännel, Strädel, Rettele, Rätzel oder Ritzel.
In der Schweiz, im Elsass und in Vorarlberg wird der Geist, der Albträume bringt, auch Dockeli, Toggeli, Doggi oder Dockie genannt. In Schlesien hießen die Alben Fenixmänneln – und die sollten auch Wechselbälger bringen.
Wie sieht der Alb aus?
Der Alb erscheint im Traum in vielen verschiedenen Gestalten, zum Beispiel als Tier. Angeblich darf der Alb dabei jede Gestalt annehmen, mit Ausnahme der einer Taube, eines Schafes oder der Biene. Seine Erscheinung ist meistens zottelig, rauhaarig und er besitzt glühende Augen. Besonders gerne verwandelt er sich in eine Katze oder einen Kater, als Pudel, schwarzer Hund, Affe, Fuchs, Bock, als schwarzes Huhn, als Pferd mit glühenden Augen, Elster, Schlange, Kröte oder Schwein.
Der Alb kann sich aber auch in einen Menschen verwandeln: Hier erscheint er als schwarze Dame, eine weiße Frau, als altes Weib mit langer Nase, als hässliches, buckeliges, graues oder rotes Männlein mit dickem Kopf, als Soldat, als hässliches Wesen, das einen großen Kopf besitzt und keine Arme und Beine hat.
Er soll darüber hinaus Vogelfüße mit drei langen Zehen haben, von denen zwei nach vorne und eine nach hinten steht, große Augen, eine lange Nase, eiskalte Hände oder auch nur einen Fuß besitzen.
Den Alb kann man auch hören, wenn er nachts ans Bett schleicht. Dabei macht er Geräusche, wie wenn jemand einen nassen Sack über den Boden schleift oder sein Gang hört sich auch an wie Filzschuhe. Der Alb verschwindet als Feuerflamme oder weißer Nebel.
Natürlich kann der Mensch den ungebetenen Gast auch fangen: Und zwar in den Gestalten, in denen er gefunden wird: Dazu zählen eine Kornähre, ein Apfel, eine Birne, die Feder, die Pantoffel, eine Nadel, ein Wollfaden oder auch Menschenhaar.
In späteren Überlieferungen spielen auch die Vorstellungen der menschlichen Seele in die Erscheinungsform des Alb mit hinein – so erscheint er als weiße Taube, als weißer oder grauer Schmetterling, als Fliege mit roten Streifen um den Hals, als Rauch, als Maus oder Katze mit Menschengesicht.[7]
Wer oder was ist der Alb?
Nur noch im Südwesten wird der Alb als eigenständiger Dämon bezeichnet, der wie in der Steiermark von den Zwergen und Kobolden abstammt oder wie im Elsass als Dorfgeist bezeichnet wird.
Ab und zu wurde der Alb auch als Geist eines Verstorbenen bezeichnet, den man dadurch befreien kann, indem man für den Toten Messen lesen lässt.
Im Mittelalter gab es den Glauben, dass der Alb eine Frühgeburt ist. Es gibt heute auch vereinzelt die Ansicht, dass der Alb die Seele eines Menschen ist, der seine Seele oder seinen Geist zum Schläfer aussendet. Den Albsender, der sich zum Beispiel in einen Schmetterling verwandeln kann, darf man währenddessen nicht anstoßen oder bewegen, denn sonst könnte seine Seele nicht mehr zurück finden.
Es gibt auch Überlieferungen, nach denen der Seele durch drei gezeichnete Kreuze auf dem Körper der Rückweg versperrt ist. Sie wird dann gefangen gehalten und erst nach einigen Tagen wieder zurück in den Körper gelassen, der gerade beerdigt werden soll.
Wenn
der Alb drückt
Nach moderneren Vorstellungen ist der Alb keine
Wesenheit, sondern ein Mensch, der von der Geburt an diese Eigenschaften des
„Albdrückers“ in sich trägt. Er macht es auch nicht freiwillig,
sondern wahrscheinlich aus Liebessehnsucht oder krankhaftem Drang. Von
sieben Jungen und sieben Mädchen soll eines ein so genannter Nachtmahr
sein. Es gibt Möglichkeiten, den Nachtmahr frühzeitig zu erkennen:
Beispielsweise wird ein Kind zum Alb, das mit Zähnen auf die Welt kommt. Außerdem
werden Kinder zu Alben, die am Sonntag in der Geisterstunde, unter einem bösen
Stern oder drei Tage vor St. Galli am 16. Oktober geworden wurden. Auch wenn
die Mutter bei der Geburt den Teufel angerufen hat, die Hebamme das Kind mit
einem Zauber zur Welt gebracht hat oder wenn der Pate ein Alb war.
Es reicht aber auch aus, wenn einer der Paten bei
der Taufe an einen Alb gedacht hat oder dem zu taufenden Kind gewünscht
hat, dass es zum Alb wird. Der Pate kann seinen Täufling auch aus Versehen
zum Alb machen, wenn er nicht vor der Kirchentür wartet, bis ihn der
Priester herein ruft. Außerdem wird das Kind zum Mahr, wenn bei der Taufe
ein Fremder durch das Schlüsselloch der Sakristei schaut. Oder wenn der
Priester das Kind im Namen des „Mahrtes und des Mondes“ statt des
„Vaters und des Sohnes“ tauft. Diese Kinder kann man durch eine erneute
Taufe vom Alb befreien.
Nach diesen Überlieferungen wurde der Alb im
Altertum als Krankheit gesehen, wie zum Beispiel die Mondsucht, die auch
eine verwandte Krankheit des Albens sein soll.
Daher kommt auch der Glaube, dass man die, die
unter der Nachtmahrt leiden, während so einer „Irrfahrt“ nicht beim
Namen rufen darf, da sie sich sonst Arme und Beine brechen können. Unter
Umständen bringt eine zweite Taufe Heilung gegen den Alb. Eine blutrünstigere
Heilungsmethode gegen die Krankheit ist, wenn der Alb die beste Kuh, den
Hund, eine Henne oder etwas anderes, was ihm sein Opfer freiwillig geschenkt
wird, erdrücken darf.
Was
tut der Alb?
Ein Mensch, der vom Alb befallen ist, merkt dies
hauptsächlich durch das Drücken. Der Alb kommt nur in der Nacht und zwar
durchs Schlüsselloch, durch ein Astloch in der Tür oder Wand oder durch
den Rauchfang. Er kommt jedoch niemals durch die geöffnete Tür oder das
offene Fenster. Wenn er sich anschleicht, kündigt er sich durch ein
Rauschen oder Klingeln, das Schritt einer Katze oder das Knabbern einer Maus
an.
Ist sein Opfer noch wach ist, schläft dieses
ganz schnell durch den Blick des Albs oder durch den Atem ein. Mit einem
Satz hockt der Alb dann auf der Brust seines Opfers oder er beginnt bei den
Füßen und kriecht ihm ganz langsam bis zum Hals hinauf. Sitzt er auf der
Brust, bemerkt der Schlafende das, weil ihm der Alb den Atem abdrückt. Dann
würgt er den Hals oder steckt seinen Finger und seine Zunge in den Mund des
Schlafenden. Er bläst seinem Opfer auch in den Mund oder zerkratzt das
Gesicht des Schläfers.
Der Alb kann sein Opfer auch in ein Pferd
verwandeln, in dem er ihn ein Halfter überwirft.
Nicht nur auf Erwachsene, sondern auch auf Kinder
hat es der Alb abgesehen. Er setzt sich bei Kindern nicht nur auf die Brust,
sondern saugt auch – die sollen dann dicke Brüste bekommen, aus denen
Milch fließt. Bei stillenden Müttern werden die Brüste überdimensional
groß, wenn der Alb an ihnen gesaugt hat.
Von den Slawen kam der Glaube, dass der Alb wie
der Vampir seinem Opfer das Blut aussaugen soll und es dazu in Arme und
Beine beißt. Auch Tiere fallen dem Alb zum Opfer. Bei Pferden verfilzt der
Alb die Mähne, weil er auf ihnen reitet und ihm diese als Zügel dient. Die
vom Alb verwendete Mähne muss dann mit einer geweihten Kerze ausgeschnitten
und anschließend verbrannt werden.
Dass ein Pferd vom Alb geritten wurde, erkennt
der Mensch daran, weil dieses am nächsten Morgen mit Schweiß bedeckt ist
und keucht. Auch auf Kühe hat es der Alb abgesehen – hier bringt er die
Seile durcheinander. Selbst andere Tiere wie Schweine, Kaninchen, Hühner
oder Gänse sind vor dem Alb nicht sicher – die tötet er durch Erdrücken.
Eine andere Überlieferung sagt, dass der Alb
auch Holz, Balken und besonders gerne Birken und Eschen drückt. Die Bäume
zittern und sterben schließlich. Muss jedoch der Baum gefällt werden, so
muss auch der vom Alb befallene Mensch sterben.
Selbst mit der Hexe hat der Alb einige
Gemeinsamkeiten. So kann auch er durchs Geäst fahren – wo er rastet oder
einen Baum drückt, entstehen Misteln, das so genannte Albennest. Wird ein
Mensch von herabfallenden Tau- oder Regentropfen aus diesem Albennest
getroffen, wird er in der Nacht vom Alb heimgesucht.
Und natürlich werden dem Alb auch Krankheiten
nachgesagt – beispielsweise geistige Störungen. Ein schwachsinniger
Mensch oder ein Dummkopf wurde früher auch Alp, Elwe, Alpschwanz, Alpschuss
oder Elbentrötsch genannt.
Und
der Alb versteckt gerne Dinge, in dem er sich darauf setzt. Aus dem
klassischen Altertum (ungefähr 4. Jahrhundert vor Christus) kommt der
Glaube, dass der Alb auch mit den Frauen, die er aufsucht, Kinder zeugt.
Dies war auch bis ins 18. Jahrhundert hinein als Bestandteil des Hexen- und
Teufelsglaubens. Das aus dieser Verbindung entstandene Kind heißt „Alperkalb“
und ist eine Miss- oder Frühgeburt.
Wie
wehrt man den Alb ab?
Hier sind
verschiedene Möglichkeiten des Albfangs, der Albabwehr oder der Vertreibung
des Albs überliefert. Will man den Alb zum Beispiel vom Haus, vom Stall,
vom Schlafzimmer, dem Bett oder vom Menschen selbst fern halten, wurde das
Penta- oder Hexagramm benutzt, das auf Tür, Bett, Wiege gemalt oder
geschnitzt wurde. Verstärken konnte man diesen Fernhalte-Zauber auch durch
die Buchstaben C+M+B.
In Tirol
verwendeten die Menschen das so genannte Schrattlgatterl, ein gitterähnliches
Gebilde, das aus fünf schmalen, ineinander geschobenen Spänen von
geweihtem Stechpalmenholz angefertigt wurde.
Wollte man den Alb
von sich fern halten, machte man diese Zeichen aus geweihtem Wachs und trug
sie beim Herzen.
Andere Methoden
zur Albenabwehr sind das Einritzen des Kreuzes in den Türstock oder das
Schreiben der Namen Ennoch und Elias mit Dreikönigskreide an die Türe. Um
den Alb vom Kind fern zu halten konnte man diese Namen auch mit einem roten
Stift auf einen Zettel schreiben und diesen dann dem Kind aufs Herz legen.
Weitere Möglichkeiten
waren geweihte Zweige von der Stechpalme, die mit Palmweiden zusammen
geflochten waren oder einen Holz-Kochlöffel an der Tür anzubringen. Man
konnte auch zwei gekreuzte Besen verkehrt herum hinter die Tür oder in die
Ecke der Stube stellen oder einen Besen in die Wiege zu legen.
Um die Hühner
gegen den Alb zu schützen, legte man Stechpalmenzweige in die Hühnersteige.
Als Abwehrmittel gegen den Alb galten auch Weihwasser, das Agathenbrot, das
am 5. Februar, dem Tag der Heiligen Agathe geweiht war, Allermannsharnisch
sowie das Horn eines schwarzen Bocks, der aber auch als Tier gegen den Alb
schützte. Die Menschen verwendeten auch den Zahn eines Wolfs, das Fell
eines Esels oder eines Wolfs, das zum Zudecken benutzt wurde sowie einen
Pferdeschädel, der ganz nach unten in die Krippe gelegt wurde.
Da der Alb auch
durch Schlüssellöcher kommen konnte, wurden diese durch einen Schlüssel
mit einem Kreuz gesichert. Man konnte aber die Bibel, ein Gesangbuch, ein
Kleidungsstück oder etwas anderes Heiliges davor legen oder davor hängen.
Eine andere
Methode war, ein Loch in die Tür zu bohren, dieses mit geweihtem Wachs zu füllen
und dann wieder zu verbohren. Um Pferde vor dem Alb zu schützen, gab man
Pferdehaare in ein Loch und schlug dieses mit einem Pflock zu. Alternativ
konnte das Loch auch offen gelassen werden – davor stellte man einen Kübel
mit Wasser. Der Alb, der in diesen Kübel fiel, musste darin ertinken.
Eine weitere
Methode war, im Stall oder in die Stube Messer oder andere spitze Gegenstände
aus Stahl zu stellen, da sich der Alb daran verletzen könnte. Da Stahl als
modernes Material von Hexen und bösen Geistern gemieden wird, werden sie
dadurch auch abgewehrt. Dazu musste man zwei Messer mit der Schneide in den
Eckpfeiler des Stalls stecken, wobei die Schneide nach außen zeigt. Wollte
man mit dem Stahl die Stube schützen, so steckte man dieses mit der
Schneide nach oben ins Kopfstück der Bettlade –die Messer sollten dabei
ein Kreuz bilden. Sie können auch in die Wand übers Bett oder in die Tür
oder in die Türschwelle gesteckt werden. Alternativ konnte man die Messer
mit der Spitze gegen die Tür zeigend vors Bett, unters Bett oder unters
Kopfkissen legen.
Wurde das Messer
dem Kind vom Paten geschenkt, musste es in die Wiege getan werden.
Wieder andere Möglichkeiten
sind Degen, die überkreuzt in die Stube gestellt oder in die Wiege gelegt
werden, eine Schere im Stroh des Bettes, ein Beil, das mit der Schneide nach
oben ins Bett gelegt wird. Sensen wurden mit der Schneide nach oben im Stall
aufgehängt – aus dem selben Grund hängten die Menschen auch Sensen in
den Rauchfang.
Über der
Verschlag der Pferde und auch im Schlafzimmer brachte man so genannte „Trudenspiegel“
an. Truden waren unfruchtbare Frauen, die genau so wie der Alb die Menschen
im Schlaf drückten. Drei Trudenspiegel, vor denen geweihte Kerzen brannten,
waren notwendig, um die Trude so zu erschrecken, dass sie auf der Stelle
verschwand.
Um die Trude zu
vertreiben, wurde an die Wiege einer Drutenstein gehängt, das war ein
kleiner runder Stein mit einem Loch. Auch eine Handspindel lenkte die Trude
ab – denn entweder dessen Klappern vertrieb das böse Wesen oder sie
musste die ganze Nacht über spinnen.
Auch eine Puppe
hielt den Alb von seinem bösen Werk ab – fand er eine, dann musste er mit
ihr spielen. Selbst Essen auf dem Tisch oder Öl hielten die Mahr oder den
Alb davon ab, die Menschen zu drücken. Man konnte auch vor dem zu Bett
gehen Arme und Beine kreuzen oder beim Ausziehen Schuhe und Pantoffeln
verkehrt vors Bett stellen oder so herum drehen, dass sich die Spitzen berühren.
Dann dachte der Alb, dass der Mensch schon wieder aufgestanden ist.
Auch auf einem hölzernen
Stiefel, der übers Bett gehängt wird oder auf einem Strauchbesen lässt
sich der Alb nieder und bleibt dort.
Eine frisch
gebackene Mutter zieht das Hemd des Mannes an oder legt aufs Bett ihres
Kindes die Hose des Mannes. Der Mann kann sich wiederum Kot auf die
Brustwarzen reiben. Das Kind konnte geschützt werden, indem man ihm die
schmutzigen Windeln auf die Brust legte, oder seine Brüste mit Hühnermist,
Tabaksaft oder Steinöl einrieb.
Es gab auch einen
Mahrt oder Trudenssegen, der vor dem Schlafengehen gesprochen wurde. In
diesem Segen wurden dem Wesen Aufgaben gestellt, die es vor Tagesanbruch unmöglich
lösen konnte. Man konnte auch rücklings ins Bett steigen, sich auf den
Bauch legen – auf keinen Fall durfte man auf dem Rücken einschlafen.
Wenn der Alb trotz
dieser Vorkehrungen den Schlafenden befallen hatte, so musste man ihm das
Wiederkommen unmöglich machen. Beispielsweise konnten alle im Schlafzimmer
Anwesenden den Namen des vom Alb Befallenen rufen – und zwar seinen
Taufnamen, da dieser auch zugleich der Name seines Schutzheiligen sein soll.
Es reicht auch,
dass man eine Schüssel Wasser über das Opfer gießt.
Wenn das Alb-Opfer
fähig ist, sich zu bewegen, muss er sich auf die Seite drehen oder die
Daumen einziehen, die große Zehe bewegen, schreien oder fluchen, beten, die
Namen Jesus, Jesus Maria und Josef aussprechen, die Namen von Vater und
Mutter oder den Taufnahmen seines Bruders sagen. Er kann auch mit der Zunge
am Gaumen drei Mal ein Kreuz machen.
Wenn der Befallene
eine Vermutung hat, wer der Alb in Wirklichkeit ist, kann er auch dessen
Namen rufen oder verschiedene Frauennamen – so lange, bis er den richtigen
Namen erwischt hat.
Will man den Alb
fangen, kann ein Freund des Opfers aber auch das Loch, durch das der Unhold
gekommen ist, fest zu machen. Alternativ kann man auch versuchen, den Alb
fest zu halten, was aber Besten mit Handschuhen oder mit den Händen
geschieht, die zuvor mit grüner Seife eingeschmiert wurden. Eine andere
Methode ist, den Alb mit einem Seil, das sich der Schlafende davor unter den
Körper gelegt hat und dessen Ende er in der Hand hält, oder mit einem
Tuch, das zuvor über das Opfer gebreitet wurde, zu fangen. Im letzteren
Fall muss man das, was man mit dem Tuch ergreift, an die Wand nageln.
Und es gibt noch
ein paar andere Mittelchen, den Alb zu fangen. Zum Beispiel, indem man einen
Laib Brot in der Schublade umdreht – so wird verhindert, dass der Alb aus
dem Zimmer kann. Oder man wirft ein Kopfkissen in die Mitte des Zimmers, auf
das man den Alb bannen kann.
Hat man den Alb
eingefangen, so wird er in der Nacht als Strohalm, Nadel oder etwas anderes
Kleines erscheinen. Jetzt kann das Opfer alles Mögliche mit ihm anstellen
– misshandeln, anbrennen, zerschneiden, auspeitschen usw. Diese Spuren der
„Folter“ hat der „albende“ Mensch am nächsten Tag auf seinem Körper.
Und er wird auch nicht mehr wieder kommen. Alternativ kann man den Alb auch
erlauben, ein anderes Lebewesen zu erdrücken, beispielsweise einen Baum
oder ein Tier, das dem Opfer gehört. Auch dann ist der Befallene vom Alb
befreit.
Wenn man den Alb
bis zum nächsten Morgen gefangen hält, muss der in seiner wahren Gestalt
erscheinen. Meistens ist es ein Mädchen, das nun vollkommen nackt ist und
bei seinem Opfer als Magd oder auch als Ehefrau bleiben muss. Sie kann nur
dann fliehen, wenn der vom Alb Befallene das verstopfte Loch frei macht oder
die Albfrau schimpft. Heiraten die beiden, wird im Volksmund auch von der
„Mahrtenehe“ gesprochen.[8]
Konnte der Alb
jedoch entkommen, musste man ihn wieder einladen – und zwar entweder am nächsten
Morgen oder am nächsten Sonntag, indem man ihm eine Schnitte Brot, etwas zu
essen und zu trinken oder Salz, Mehl und Eier (die drei weißen Gaben)
verspricht. Man kann den Alb auch dazu auffordern, sich etwas zu leihen oder
Feuer zu holen. Auf jeden Fall kommt der Alb dann in seiner wahren Gestalt
und kann so erkannt werden. Dann kann man ihn mit dem Besen wieder zur Tür
hinaus befördern. Oder man gibt ihm das Versprochene – allerdings mit der
linken Hand. Er nimmt es dann und lässt sich nicht wieder blicken.
Eine weitere
Methode ist, dass der vom Alb Befallene aufs Klo geht und sein Urin in ein
neues Gefäß füllt, das er fest verschließen muss. Dann findet sich der
Alb am anderen Tag in seiner menschlichen Gestalt ein und bittet sein Opfer,
dieses Gefäß zu öffnen. Denn so lange es fest verschlossen ist, kann er
selbst nicht urinieren. Schlägt man dem Alb diese Bitte aus, muss er
sterben.
[1]
Mit dem Namen Kopten bezeichnete man ursprünglich die Einwohner
Alexandriens und ganz Ägyptens. Die koptische Sprache stammt aus dem 3.
Jahrhundert nach Christus. Als Ägypten zunehmend islamisiert und
arabisiert wurde, wurde der Name Kopten ausschließlich für die
Christen der koptischen Kirchen gebraucht. Auch heute noch gibt es rund
fünf bis acht Millionen Kopten.
[2]
Das älteste bekannte Königsgeschlecht der Franken vom 5. bis in die
Mitte des 8. Jahrhunderts. Sie wurden um 751 von den Karolingern verdrängt.
[3]
Der Alb galt früher als eigenständiger Dämon, wurde aber meist auf
den Schlaf eingeschränkt wurde. Er ist der Verursacher des Alp- oder
Albtraums.
[4]
Den Namen Snorra-Edda hat die Prosa-Edda von Snorri Sturluson, einem isländischen
Dichter und Historiker.
[5]
Olav II. Haraldsson, ein norwegischer König, 995 bis 1030
[6]
Der Incubus und sein weiblicher Gegenpol der Succubus stammen aus der
christlichen und jüdischen Mythologie. Der Name Incubus kommt aus dem
Lateinischen incubare und bedeutet „oben liegen, ausbrüten“. Incubi
ernähren sich von der Energie schlafender Frauen, mit denen sie in der
Nacht Geschlechtsverkehr haben. Die schlafende Frau kann sich nur in
Form eines Traums daran erinnern. Auch das Verhalten der Succubi (vom
Lateinischen succumbere – „unten liegen“) ist genau so wie bei den
Incubi. Für diese Sünde konnte der Schlafende nicht verantwortlich
gemacht werden, weil er sich ja nicht daran erinnern konnte und es außerdem
eine übernatürliche Macht war.
[7]
Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, S. 828 (vgl. HWA Bd. 1, S.
283 ff.)
[8]
Lexikon: Alp. Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, S. 857 (vgl.
HWA Bd. 1, S. 302 ff.)